
Landesgeschichte: Übersicht | Frühzeit | Deutsche Eroberung | Mark Meißen | Kurfürstentum Sachsen | Reformation, Kurfürst Moritz | Kurfürst August | Dreißigjähriger Krieg | August der Starke | Friedrich August III. | Napoleonische Zeit | Industrialisierung, Revolution | Ende Monarchie, Weltkrieg | Nachkriegszeit, DDR, Wende
Kulturgeschichte: Bildung & Wissenschaft | Buch- & Verlagswesen | Bildende Kunst | Musik & Tanz | Theater & Literatur

Sächsische Landesgeschichte in Stichpunkten
Frühgeschichte Steinzeit, Lausitzer Kultur, Germanen, Westslawen, Elbsorben
- frühe Besiedlung des Gebietes um Elbe und Saale: Funde aus der Altsteinzeit (z. B. bei Markkleeberg südlich von Leipzig mit tausenden Objekten aus dem Paläolithikum - 250.000 v. Chr.), feste dörfliche Siedlungen in den Gebieten mit fruchtbarem Lößboden spätestens im 4. Jahrtausend v. Chr. (erste wichtige Siedlungsgebiete waren z. B. das Dresdner Elbtal zwischen Pirna und Meißen, das Gebiet zwischen Meißen, Riesa und Grimma und der Leipziger Raum)
- 13. Jahrhundert v. Chr.: Ausbreitung der aus Osteuropa kommenden Lausitzer (Lausitzischen) Kultur über das sächsische Territorium bis in die bis dahin noch unbesiedelten Gebiete des Erzgebirgsvorlandes und des Vogtlandes, La-Tène-Zeit (etwa 200 v. Chr.): Vordringen germanischer Stämme der Jastorfkultur aus Norddeutschland (dort seit etwa 800 v. Chr. lebend) in den sächsischen Raum und nach Nordböhmen, erste Jahrhunderte u. Z.: Siedlungen des germanischen Stammes der Hermunduren im Gebiet der mittleren Elbe (in antiken Schriften erwähnt)
- Zeit der Völkerwanderung (4. bis 7. Jahrhundert): Abzug der germanischen Stämme nach Westen, 6. Jahrhundert: Nachrücken westslawischer Stämme (der Sorben) in mehreren Besiedlungswellen von Süden über die Pässe des Osterzgebirges in das sächsische Elbland und von Osten in das Gebiet Lausitz um Spree und Neiße (wahrscheinlich überwiegend als friedliche Landnahme in den von den Germanen verlassenen Gebieten), Gründung der Gaue Milska (Gebiet um Bautzen), Zagost (östlich von Bautzen an der Neiße), Nisan (altsorbisch: Tiefland; Elbtalgebiet zwischen Pirna und Meißen) und Daleminzien (um Lommatzsch) in Gebieten mit fruchtbaren Böden, Anlage zahlreicher Dörfer (Weiler) und Rodungen in deren Umfeld, Wirtschaftszweige: Ackerbau, Viehzucht, Fischfang, Bienenzucht und Jagd, Bau großer Stammesburgen (z. B. der Hauptfluchtburg der Daleminzier in Gana) und kleinerer von Ringwällen geschützter Wehranlagen als Zufluchtstätten, zwischen den von Süden her und den von Osten her besiedelten Gauen lag ein schwer passierbarer Grenzwald (Reste blieben als Friedewald, Laußnitzer Wald, Dresdner Heide und Masseneiwald erhalten) - er bildete noch lange Zeit die Grenzen zwischen der Mark Meißen und der zu Böhmen gehörenden Oberlausitz
150-929: Die Sachsen, Deutsche Eroberung der slawischen Siedlungsgebiete
- Erwähnung der in Holstein lebenden Westgermanen als Saxones (von Sahs abgeleitet, dem einschneidigen Schwert der Westgermanen), 5. Jahrhundert: Ausbreitung der Sachsen im Westen bis nach England (Angelsachsen) und im Osten bis in das Saalegebiet hinein, 8. Jahrhundert: Besiedlung fast des gesamten norddeutschen Raumes, Sachsenkriege (772-804): Unterwerfung und Christianisierung der Sachsen durch König Karl den Großen (768-814, Herrscher des Frankenreiches), um 805: Unterwerfung der Daleminzier und anderer sorbischer Stämme durch König Karl den Großen, Zwang zur Tributzahlung und Heerfolge (Stellung von Truppenkontingenten)
- ab 880 (nach dem Zerfall des Frankenreiches): Bildung des Stammesherzogtums Sachsen (bestand bis zur Zerschlagung durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa im Jahr 1180 nach dem Sturz Heinrichs des Löwen) im Gebiet zwischen der Lippe und dem Harz, regiert von einem Sachsenherzog (Dux totius Saxoniae, die Liudolfinger waren das vorherrschende Fürstengeschlecht), Sachsen war das mächtigste der vier großen, aus dem Zerfall des Karolingerreiches (des Reiches Karls des Großen) hervorgegangenen Herzogtümer, 908: Eingliederung des Herzogtums Thüringen, wenig später des Merseburger Landes
- 919 (in Fritzlar): Wahl von Herzog Heinrich von Sachsen (873-936) zum deutschen König Heinrich I. durch die versammelten deutschen Fürsten, Stärkung der Zentralgewalt im Deutschen Reich, Erklärung der Sicherung und Ausweitung der Ostgrenzen des Reiches zur politischen Hauptaufgabe, 926: Waffenstillstand zwischen König Heinrich I. und den Ungarn (ungarische Einfälle in das deutsche Reich - mit den slawischen Siedlungsgebieten als Aufmarschbasis - hatte es ab 906 gegeben), bis 929: Unterwerfung der zwischen Saale und Oder lebenden Slawen (nach germanischem Recht waren die eroberten Territorien Königsland), Winter 928/929: Sieg König Heinrichs I. über die Heveller, Eroberung ihrer Feste Brennabor (Brandenburg), Frühjahr 929: Eroberung der Stammesburg der Daleminzier (Burg Gana, am Jahna-Bach beim heutigen Dorf Hof bei Stauchitz gelegen), Feldzug nach Böhmen (Herzog Wenzel I. wurde tributpflichtig und lehnsabhängig)
929-1423: Mark Meißen, Die Wettiner als Meißner Markgrafen
- 929: Gründung eines befestigten Militärlagers ihm eroberten Siedlungsraum der Daleminzier auf einem zwischen Triebisch und Meisabach strategisch günstig gelegenen Bergsporn über der Elbe (auf dem späteren Meißner Burgberg) durch König Heinrich I., Entwicklung der Burg Misni (erster befestigter Stützpunkt der Deutschen im Land der Slawen, nach dem Flüsschen Meisa benannt) zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Region
- 932: Unterwerfung des im Gebiet um Bautzen lebenden sorbischen Stammes der Milzener durch königliche Truppen, Zerstörung der Feste Liubusua (wahrscheinlich bei Luckau gelegen) der Lusizer (der in der Lausitz lebenden Slawen), 933: Sieg über das Ungarn-Heer bei Riade (wahrscheinlich am Zusammenfluss von Helme und Unstrut gelegen)
- 936-973: Regierung von König Otto I. (dem Großen, 962 zum Kaiser gekrönt), 965: Gründung der Markgrafschaft Meißen (dem König direkt unterstehend, Burg Meißen als Markgrafensitz, der Markgraf als ein mit Königsgut belehnter königlicher Amtsträger), Bau von Hauptburgen und zahlreichen kleinen Burgwarden überall im eroberten Land (oft am Ort früherer slawischer Burganlagen), Verwaltung der sorbischen Dörfer mit Hilfe der slawischen Dorfältesten (Supanen), Bau erster Kirchen an den Orten der Hauptburgen und einiger Burgwarde, 968: Gründung des Bistums Meißen, Beginn der (zunächst sehr schleppend verlaufenden) Missionierung der Slawen
- bis 1031: Eroberungsversuche aus Böhmen und Polen (nur vorübergehend z. B. im Gebiet Bautzen erfolgreich), Regierung der Mark Meißen zunächst wie eine Militärdiktatur, Ansiedlung königlicher Beamter und deutscher Ritter mit ihren Angehörigen und Bediensteten in der Markgrafschaft (herrschten mit der Heeresmacht im Rücken über die slawische Bevölkerung), Einrichtung erster Handelsstützpunkte durch deutsche Kaufleute, aber noch keine wirkliche ansässige deutsche Bevölkerung
- 11. Jahrhundert: Beginn der Erblichkeit der Reichslehen und des Amtes des Markgrafen (war nun kein jederzeit austauschbarer Statthalter des Königs mehr), Aufbau eigener Herrschaften des Bischofs, des Burggrafen und weiterer Adliger mit eigenem Grundbesitz (vom König oder Markgrafen als Lehen oder in Anerkennung besonderer Verdienste als Eigentum/Allodialbesitz vergeben), Ende des 11. Jahrhunderts: Machtantritt des Geschlechts der Wettiner in der Markgrafschaft Meißen (stellten nun mehr als 800 Jahre lang - bis zur Abdankung des letzten sächsischen Königs im Jahr 1918 - die meißnischen, dann sächsischen Landesherren), 1071: Ersterwähnung der Wettiner (Thimo von Kistritz bei Weißenfels bezeichnete sich nach seiner Stammburg Wettin bei Halle als Graf von Wettin), besaßen Eigentum in Thüringen, Schwaben, im Vorharz und in Eilenburg
- 1089-1103: Regierung von Heinrich I. von Eilenburg als erster wettinischer Markgraf von Meißen (war ab 1081 Markgraf der Ostmark, der späteren Niederlausitz)
- 1103-1123: Regierung von Markgraf Heinrich II. von Eilenburg, ab 1105 (zweite Phase der deutschen Ostexpansion): Einwanderung thüringischer und fränkischer Bauern, Anlage neuer Dörfer, Rodungen für Ackerland, Anlage frühstädtischer Marktsiedlungen und Handelsstützpunkte im Schutz der Burgen (z. B. Meißen und Pirna)
- 1123-1156: Regierung von Markgraf Konrad (dem Großen), turbulente Machtübernahme wegen der Konkurrenz durch den von Kaiser Heinrich V. favorisierten Wiprecht von Groitzsch (Gründer des Benediktinerklosters Pegau, des ersten Klosters östlich der Saale), Ausdehnung der Mark Meißen annähernd bis zu den Grenzen des späteren Landes Sachsen, 1156: Abdankung Konrads des Großen (nach einem Konflikt mit Heinrich dem Löwen), Eintritt als Laienbruder in sein Familienkloster auf dem Petersberg bei Halle (dort auch beigesetzt), Aufteilung des Besitzes unter seine fünf Söhne (ohne Zustimmung seines Lehnsherrn, des deutschen Königs, Konrad betrachtete das ihm als Lehen überlassene königliche Land als persönliches Eigentum, die Mark Meißen blieb nun trotz mehrerer Versuche deutscher Könige, die Lehnshoheit zurückzuerlangen, Erbeigentum der Wettiner)
- 1156-1190: Regierung von Markgraf Otto (dem Reichen, ältester Sohn Konrads), musste sich wegen der Erbteilung mit einem relativ kleinen Territorium begnügen, 1162: Stiftung des Zisterzienserklosters Altzella (bei Nossen) durch Markgraf Otto als Hauskloster und neue Grablege der Wettiner (durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa zur freien Abtei erklärt), Zuteilung von 800 Hufen Land zwischen Roßwein, Nossen, Freiberg und Hainichen (hatte Markgraf Otto auf eigene Kosten roden lassen), Förderung der bäuerlichen Besiedlung dieses fruchtbaren, bis dahin noch kaum bewohnten Gebietes durch den Zisterzienserorden, 1165: Stadtrecht und Messeprivileg für Leipzig
- um 1168: Beginn des erzgebirgischen Silberbergbaus mit ersten Silberfunden in Christiansdorf (Freiberg), Übernahme dieses im Grundbesitz des Klosters Altzella gelegenen Fundgebietes durch Markgraf Otto gegen Gebietsausgleich, Stadtprivileg für Freiberg, Entwicklung der Bergstadt Freiberg zum reichsten und wirtschaftlich bedeutendsten Ort Sachsens, Bau neuer Straßen und zahlreicher Siedlungen in dem bis dahin kaum bewohnten Erzgebirge, rasante wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Mark Meißen durch den Silberbergbau
- 1190-1195: Regierung von Markgraf Albrecht I. (dem Stolzen), 1195-1221: Regierung von Markgraf Dietrich (dem Bedrängten), 1206: erste urkundliche Erwähnung von Dresden und 1216 Erwähnung als civitas (Stadt im vollen Rechtssinn)
- 1221-1288: Regierung von Markgraf Heinrich (dem Erlauchten), Ausdehnung der Mark Meißen über das südöstliche Erzgebirge (durch Heirat mit der böhmischen Königstochter), 1288-1306: Regierung von Markgraf Albrecht II. (dem Entarteten), Erwerb des Pleißener Landes als Mitgift seiner Gemahlin (Kaisertochter Margarethe) und später auch Thüringens
- 1306-1324: Regierung der Mark Meißen und der Landgrafschaft Thüringen durch Markgraf Friedrich I. (dem Freidigen) zunächst zusammen mit seinem Bruder Diezmann (1307 während einer Messe in der Leipziger Thomaskirche erstochen), 1307: Sieg von Markgraf Friedrich und Diezmann im Gefecht bei Lucka über Truppen des Königs Albrecht I. (dieser hatte versucht, die Macht der Wettiner zu brechen und deren Herrschaftsgebiet wieder in unmittelbare königliche Gewalt zu bringen)
- 1324-1349: Regierung von Markgraf Friedrich II. (dem Ernsthaften), 1349-1381: Regierung von Markgraf Friedrich III. (dem Strengen), 1381-1423: Regierung von Markgraf Friedrich IV. (dem Streitbaren; war dann 1423-1428 Kurfürst von Sachsen), 1409: Gründung der Universität Leipzig (unter Beteiligung von Professoren und Studenten, die vor der tschechischen Nationalbewegung aus Prag geflohen waren)
1423-1517: Kurfürstentum Sachsen, Leipziger Teilung des Wettinischen Besitzes
- 1423 (nach dem Tod des kinderlosen Askaniers Albrecht III. von Sachsen-Wittenberg, an dieses Herzogtum war seit 1356 die Kurwürde gebunden): Übernahme der Kurwürde durch Markgraf Friedrich IV. von Meißen aus der Hand König Sigmunds (förmliche Belehnung erst 1425; die Rolle der Mark Meißen als Bollwerk der deutschen Lande z. B. in den Konflikten mit den Brandenburgern und den Hussiten hatte den Wettinern Vorrang vor den anderen Bewerbern um die Nachfolge der Askanier verschafft), bis 1428: Regierung Friedrichs als Kurfürst Friedrich I. von Sachsen (die Wettiner waren nun an der Wahl/Kür des deutschen Königs beteiligt, das markgräfliche Wappen wurde durch ein kurfürstliches Wappen mit gekreuzten roten Kurschwertern auf weiß-schwarzem Grund und den Rauten der Askanier ersetzt, die Wettiner waren nun auch Herzöge von Sachsen-Wittenberg, Landgrafen von Thüringen sowie Erzmarschall und Reichsvikar = Reichsverweser in Zeiten eines unbesetzten Thrones), Übernahme der Bezeichnung "Sachsen" vom Herzogtum Sachsen-Wittenberg auf den gesamten wettinischen Besitz (bis 1547 auch auf den thüringischen Teil)
- 1428-1464: Regierung von Kurfürst Friedrich II. von Sachsen (dem Sanftmütigen) zusammen mit seinen Brüdern Herzog Wilhelm III., Herzog Heinrich (starb schon 1435) und Herzog Sigismund (ab 1437 Bischof von Würzburg), 1445: Altenburger Teilung (Abtretung der Landgrafschaft Thüringen und des fränkischen Besitzes an Bruder Wilhelm), Verheerung Kursachsens durch den sächsischen Bruderkrieg infolge dieser Teilung, 1451: Frieden von Naumburg (ohne Änderung der Altenburger Teilung), 1459: Grenzvertrag zwischen Kursachsen und Böhmen (Vertrag von Eger, Erzgebirgskamm als sächsisch-böhmische Grenze festgelegt, der Kurfürst musste 63 meißnische Städte und Schlösser sowie das Meißnische Vogtland vom böhmischen König Georg Podiebrad zum Lehen nehmen und seine südlich des Erzgebirges gelegenen Besitzungen Brüx und Dux aufgeben), 1459: Wechsel der böhmischen Lehen auf sächsischem Territorium in den Besitz von Kurfürst Friedrich II. nach der Heirat seines Sohnes Albrecht mit der Tochter des böhmischen Königs
- 1464-1486: Regierung von Kurfürst Ernst zusammen mit seinem Bruder Herzog Albrecht (dem Beherzten) (eine Geißelnahme der beiden im Jahr 1455 ging als Altenburger Prinzenraub in die Geschichte ein), Verlegung der Residenz von Meißen nach Dresden, um 1470: neue Silberfunde bei Schneeberg, Wiederbelebung des erzgebirgischen Bergbaus, mehrere Städtegründungen (Schneeberg 1471, Annaberg 1491, Marienberg 1521), um 1477: Höhepunkt der Silberausbeute im Schneeberger Revier
- 1485: Leipziger Teilung des wettinischen Besitzes (Kurfürst Ernst teilte den Besitz, Herzog Albrecht durfte zwischen den beiden Teilen wählen - er wählte den meißnischen Teil mit Dresden; die Wettiner verspielten damit die Chance zur führenden Rolle im deutschen Reich und wahrscheinlich auch die deutsche Königskrone, nun entwickelten sich die ernestinische und die albertinische Linie der Wettiner getrennt), Residenz von Kurfürst Ernst nun in Weimar

- 1486-1525: Regierung von Kurfürst Friedrich III. von Sachsen (dem Weisen), ab 1490: Residenz in Schloss Wittenberg, 1497: Erhebung der Leipziger Messe zur Reichsmesse mit unbeschränkter Marktfreiheit, um 1500: neuerlicher Aufschwung des Erzbergbaus, Aufschwung des Textilgewerbes, brachten den sächsischen Ländern Reichtum, rege Bautätigkeit in den Städten (Sachsen war das wirtschaftlich entwickeltste und reichste Land im deutschen Reich), 1502: Gründung der Universität Wittenberg (als ernestinisches Gegenstück zu der auf albertinischem Territorium gelegenen Universität Leipzig)
1517-1553: Reformation, Kurfürst Moritz
- 31. Oktober 1517 (Vorabend des Großen Ablassfestes zu Allerheiligen): Beginn des Aufstandes gegen die römisch-katholische Kirche, Martin Luther veröffentlichte in Wittenberg seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel (Sachsen ist das Mutterland der Reformation, Wittenberg ihre Wiege), schnelle Ausbreitung der Lehre Luthers in Deutschland durch den gerade erst erfundenen Buchdruck, die berühmte Disputation mit Dr. Eck in Leipzig (in der Pleißenburg) machte Luther als Vorkämpfer gegen das Papsttum populär, in Beisein von Herzog Georg (der Bärtige, Landesherr des albertinischen Sachsens, strebte ebenfalls eine Kirchenreform gegen Kommerzialisierung und Korruption an, wurde aber zum Gegner Luthers wegen dessen Bekenntnis zu Jan Hus)
- Kurfürst Friedrich III. von Sachsen unterstützte Luther, versteckte den nach seinem Bekenntnis vor dem Kaiser und den versammelten Fürsten auf dem Reichstag zu Worms (1521) geächteten Reformator als "Junker Jörg" auf der Wartburg, Luther begann hier die Übersetzung von Teilen des Neuen Testaments ins Deutsche (die meißnische/obersächsische Kanzleisprache wurde so zum Grundstein der modernen deutschen Sprache)
- 1521: Einführung der Reformation in der politisch sehr eigenständigen, vom Städtebürgertum dominierten Oberlausitz (das Domstift Bautzen und die Klöster Marienstern, Marienthal und Lauban blieben unter dem Einfluss der böhmischen Landesherrschaft katholisch), ab 1522: Auftreten lutherischer Prediger auch im albertinischen Sachsen, aber von Herzog Georg verfolgt, ordnete 1533 die Vertreibung lutherisch Gesinnter aus Leipzig an
- 1525: Schlacht bei Frankenhausen, Niederschlagung des großen Bauernaufstandes in Thüringen (unter der Führung des Theologen und Reformators Thomas Müntzer) durch Landgraf Philipp von Hessen, Herzog Heinrich von Braunschweig und Herzog Georg, vor allem letzterer veranlasste unmenschliche Greueltaten an den Besiegten
- 1525-1532: Regierung von Kurfürst Johann von Sachsen (Johann der Beständige), bekannte sich kompromisslos zur Reformation, schuf 1526 einen Gegenbund der Evangelischen gegen den von Herzog Georg 1525 in Dessau initiierten katholischen Bund, 1527: Kirchenvisitationen im ernestinischen Teil Sachsens, Aufbau einer Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, der Kurfürst war nun "oberster Bischof" (dem die Superintendenten direkt unterstanden, diese Einheit von Staat und Kirche endete in Sachsen erst 1918), die Landesuniversität zu Wittenberg (Wirkstätte von Luther und Melanchthon) wurde zum geistigen Mittelpunkt der neuen Lehre, Kursachsen übte nun bis 1697 (als August der Starke zum katholischen Glauben wechselte) die Führung unter den evangelischen Reichsständen aus, 1529: Einführung des Begriffs "Protestanten" (die der neuen Lehre anhängenden Fürsten bezeugten - "pro-testierten" - auf dem Reichstag zu Speyer ihren evangelischen Glauben)
- 1530: Verabschiedung der Torgauer Artikel (Grundlage der Augsburger Konfession, der ersten Zusammenfassung evangelischer Glaubensartikel), Gründung des Schmalkaldischen Bundes durch die evangelischen Reichsstände unter der Führung Kursachsens und Hessens, 1532: Nürnberger Religionsfrieden auf Betreiben Kurfürst Johanns (gewährte allen Reichsständen bis zu einem allgemeinen Konzil oder bis zum nächsten Reichstag den Frieden)
- 1532-1547: Regierung von Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen (Johann Friedrich der Großmütige), residierte ab 1536 im Torgauer Schloss Hartenfels, führte 1537 die Reformation in seinen Ämtern Freiberg und Wolkenstein ein, trat 1537 dem Schmalkaldischen Bund bei, 1539: Einführung der Reformation im albertinischen Teil Sachsens durch Herzog Heinrich (den Frommen), Kirchenvisitationen (Überprüfungen der einzelnen Pfarreien und Klöster durch Visitationskommissionen), die Kirchengüter kamen zunächst unter Sequester (Verwaltung) der Landstände
- 1541: Herzog Moritz übernahm die Regierung in dem nun ebenfalls protestantischen albertinischen Sachsen und die Führung der evangelischen Reichsstände, großer Geldzufluss durch die Auflösung (Säkularisierung) der Kirchengüter und des Klosterbesitzes, großzügiger Ausbau der Leipziger und Dresdner Stadtbefestigung, Umbau des Dresdner Schlosses, Übereignung des Paulinerklosters an die Leipziger Universität, Gründung der Fürstenschulen Meißen, Grimma und Schulpforta für die Ausbildung fähiger und treuer Staatsbeamter (sächsische Fürstenschulen als Vorläufer der deutschen Gymnasien)
- 1542: Besetzung des Wurzener Landes ("Wurzener Fladenkrieg") durch Herzog Moritz im Streit mit Kurfürst Johann Friedrich um die Aufteilung der Steuergelder aus dem gemeinsam verwalteten Stift Wurzen, ließ sich für den Abzug mit dem Amt Stolpen entschädigen, der Kaiser unterstützte Moritz und konnte ihn unter Zusicherung der Glaubensfreiheit und der Kurwürde an das katholische Lager binden, 1547: Entscheidungsschlacht des Schmalkaldischen Krieges bei Mühlberg an der Elbe nahe Torgau, Herzog Moritz kämpfte auf Seiten Kaiser Karls V. gegen die protestantischen Mächte, Wittenberger Kapitulation: Johann Friedrich verlor die Kurwürde und die Wittenberger Kurlande
- 1547-1553: Regierung von Kurfürst Moritz von Sachsen, erhielt 1547 noch im Feldlager vom Kaiser die Kurwürde verliehen als Belohnung für den Verrat an der evangelischen Sache (feierliche Belehnung mit den Kurlanden erst 1548), zu Kursachsen gehörten nun das Kurland mit Wittenberg, der ernestinische Teil der Mark Meißen und der bisherige albertinische Besitz, Moritz wechselte wieder auf die protestantische Seite (konnte die Freilassung von Landgraf Philipp von Hessen, seines Schwiegervaters, nicht erreichen und sah darin einen Vertrauensbruch des Kaisers)
- Umbau der Kurfürstlichen Residenz Dresden in eine prächtige Renaissance-Stadt, Dresden war nun Hauptstadt des führenden protestantischen Landes und Mittelpunkt des evangelischen Lebens in Deutschland, Einführung zahlreicher Neuerungen in der sächsischen Staatsverwaltung (u.a. "kollegialischer" Hofrat als oberste Behörde geschaffen, Kursachsen in fünf Kreise gegliedert, Konsistorien Meißen und Leipzig gegründet, neues Kirchengesetz verabschiedet, Erfassung der sächsischen Orte und Hufen samt Belastungen in Amtsbüchern)
- 1551: Kurfürst Moritz stellte sich an die Spitze der protestantischen Fürstenopposition gegen den Kaiser, zwang diesen zur Anerkennung des Passauer Vertrages von 1552 (sicherte den Bestand des Protestantismus und die Unabhängigkeit der Reichsfürsten, ebnete den Weg zum Augsburger Religionsfrieden), 1553: Tod von Kurfürst Moritz im lüneburgischen Sievershausen im Kampf gegen den brandenburgischen Landesherren Albrecht Alcibiades durch eine Schusswunde (eventuell durch Giftmord auf dem Krankenlager durch Anhänger der Kaiserlichen/Habsburger), in der Begräbniskapelle des Freiberger Doms beigesetzt (aufwendigstes Grabmal der Wettiner)
1553-1611: Kurfürst August, Renaissance
- 1553-1586: Regierung von Kurfürst August von Sachsen (nicht mit August dem Starken - Kurfürst Friedrich August I.- verwechseln!), wurde als letzter Kurfürst in Augsburg vom Kaiser nach altgermanischer Sitte unter freiem Himmel belehnt, übte zusammen mit seiner politisch sehr engagierten Gemahlin Anna von Dänemark eine sehr strenge und religiös intolerante Herrschaft über Kursachsen aus
- bedeutender wirtschaftlicher Aufschwung in Kursachen, Entwicklung der Residenzstadt Dresden zu einer der prächtigsten Renaissance-Städte Deutschlands und zugleich zu einer der mächtigsten Stadtfestungen Europas, Einrichtung einer bedeutenden Kurfürstlichen Bibliothek und der Kurfürstlichen Kunst- und Naturalienkammer (Dresdner Kunstkammer, eines der bedeutendsten Kunst- und Raritätenkabinette Europas, Ursprung der weltberühmten Dresdner Kunstsammlungen)
- bedeutende Territorialgewinne durch Kauf, Tausch oder Erbe (z.B. 1566 Vogtländischer Kreis mit Plauen, 1580 Grafschaft Mansfeld, 1559 bisher bischöfliche Burg Stolpen im Tausch gegen das Amt Mühlberg erworben und in eine Garnison und ein Staatsgefängnis umgebaut - das Bistum Meißen verlor hierdurch seinen Einfluss in der Oberlausitz), 1572 (nach dem Tod des letzten Meißner Burggrafen): Kurfürst August gewann die Meißner burggräfliche Reichsstandschaft nebst Titel und Wappen für das Haus Wettin
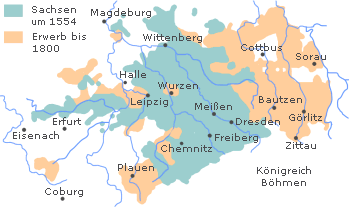
Bild: Kursachsen nach dem Naumburger Vertrag von 1554 und Landerwerb bis 1800
- Kurfürst August war erfolgreicher Unternehmer in Bergbau, Handel und Gewerbe, ließ die Dresdner "Neue Schmelzhütte" bauen und ab 1568 eine große kurfürstliche Gutswirtschaft einrichten (Vorwerk/Kammergut Ostra im Gebiet der späteren Dresdner Friedrichstadt), Bau der großen (nach Kurfürst August benannten) Augustusburg östlich von Chemnitz
- ab 1572: Fortsetzung der (von Kurfürst Moritz begonnenen) Staatsreform, Einrichtung eines Geheimen Rates (kollegiale Behörde, erste dieser Art in Deutschland), Verabschiedung der "Konstitutionen" (neue rechtliche Grundlage der Beziehungen zwischen Landesherr, Adel, Städtebürgertum und Bauernstand, erstmals in Deutschland)
- 1586-1591: Regierung von Kurfürst Christian I. von Sachsen, Außen-, Innen- und Kirchenpolitik ab 1589 weitgehend vom fähigen Kanzler Dr. Nicolaus Crell geführt, 1588: Verlegung des Konsistoriums von Dresden nach Meißen, 1589: Vereinigung des Geheimen Rates mit den Hofräten, gab dem Kanzler eine außerordentliche politische Macht, Rückgang des Einflusses der Stände auf den Landesherrn, Beginn des Absolutismus in Kursachsen
- Kanzler Crell öffnete Sachsen dem calvinistischen Gedankengut, 1589: Herausgabe eines neuen Gebetbuches, Katechismus und Gesangbuches, Crell strebte ein neues Bündnis aller protestantischen Reichsstände unter Einbeziehung der Calvinisten an (wollte die vom orthodox-lutherischen Kurfürsten August verschuldete Isolation Kursachsens beenden) sowie die Auflösung des Bündnisses mit den Habsburgern
- 1591-1611: Regierung von Kurfürst Christian II. (bis 1601 unter Vormundschaft), Rache der Landstände an Kanzler Crell (wurde wegen Begünstigung des Calvinismus auf der Festung Königstein eingesperrt und 1601 in Dresden hingerichtet), Ausschreitungen gegen die Calvinisten, Crells Reformen wurden rückgängig gemacht, 1606: das Konsistorium wieder in Dresden eingerichtet, 1607: Konsistorium und Kirchenrat zum Oberkonsistorium vereinigt, Eintritt der Landstände in ihre alten Rechte, Rückkehr Kursachsens zum orthodoxen Luthertum, Erneuerung des Bündnisses mit den Habsburgern (Bruch mit den protestantischen Reichsständen, Beginn der - später verhängnisvollen - Konflikte mit Kurbrandenburg)
1611-1694: Dreißigjähriger Krieg, Frühbarock
- 1611-1656: Regierung von Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen, behielt das Bündnis mit den Habsburgern bei (unterstützte 1612 die Wahl des Habsburgers Matthias und 1619 des Habsburgers Ferdinand II. zum Kaiser, diese gewährten den Lutheranern in den habsburgischen Ländern Glaubensfreiheit), schlug die ihm vom protestantischen böhmischen Adel angebotene böhmische Königskrone und 1619 den sich öffnenden Zugang zur Kaiserwürde aus
- 1618-1648: Dreißigjähriger Krieg, der Kurfürst operierte politisch kurzsichtig und inkonsequent, Kursachsen büßte viel von der unter Kurfürst August errungenen politischen Bedeutung und Wirtschaftskraft ein, 1620: Besetzung der zu Böhmen gehörenden evangelischen Ober- und Niederlausitz durch Kursachsen im Auftrag des Kaisers (diese beiden Lande hatten sich auf die Seite des calvinistischen Böhmenkönigs Friedrich von der Pfalz gestellt), Verpfändung der beiden Lausitzen an den Kurfürsten von Sachsen als Entschädigung für die Kriegskosten
- Schlacht am Weißen Berg bei Prag: Sieg der Kaiserlichen über den protestantischen böhmischen Adel, Schlesien unterwarf sich Kursachsen, Verfolgung der Calvinisten und Lutheraner in Böhmen und Mähren, Flucht von etwa 150.000 böhmischen Exulanten nach Sachsen (vor allem in das Erzgebirge, Städteneugründungen: z.B. Johanngeorgenstadt), die von den Exulanten mitgebrachten Gewerbe waren eine große Bereicherung der sächsischen Wirtschaft
- 1631: Wechsel Kursachsens auf die Seite Schwedens (des Königs Gustav Adolf), das sächsische Territorium war nun Operationsbasis der schwedischen Truppen, Einmarsch der von Tilly kommandierten kaiserlichen Truppen (nach der Zerstörung von Magdeburg) in Kursachsen, Sieg der Schweden bei Breitenfeld (1631) und bei Lützen (1632, König Gustav Adolf fiel in der Schlacht), die Schweden sicherten Sachsen gegen die Kaiserlichen
- Wechsel Kursachsens in das kaiserliche Lager (dem sächsischen Kurfürsten war eine Führungsrolle in der protestantischen Kriegspartei verwehrt worden und die Schweden hatten 1634 bei Nördlingen eine Schlacht verloren), 1635: Prager Friedensschluss, Vergabe der Ober- und der Niederlausitz als böhmische Lehen an Kursachsen durch den Kaiser (als Belohnung für den Verrat Kursachsens an der evangelischen Sache; größter und letzter Landgewinn in der sächsischen Geschichte, territoriale Grundlage für die spätere sächsisch-polnische Union unter August dem Starken)
- ab 1636: Einfall schwedischer Landsknechtshaufen in Kursachsen, verheerten das Land mit unvorstellbarer Gewalt, 1637: Erstürmung und Brandschatzung der Stadt Meißen, 1639: Zerstörung von Zwickau und Pirna und 1642 von Zittau und Leipzig, 1645: Neutralitätsvertrag von Kötzschenbroda zwischen Kurfürst Johann Georg I. und dem schwedischen General Königsmark, Ende der Kriegshandlungen in Sachsen
- 1648: Westfälischer Frieden - ohne Mitspracherecht des verarmten und politisch nun bedeutungslosen Kursachsen, nun vom mächtigen habsburgischen Nachbarn politisch abhängig, Verlust des Gebietes Magdeburg (fiel 1680 als Herzogtum an Brandenburg), 1656: Abtrennung der Fürstentümer Sachsen-Merseburg, Sachsen-Zeitz und Sachsen-Weißenfels (Johann Georg I. hatte sie testamentarisch zur Bildung von Sekundogenituren für die nicht nachfolgeberechtigten Prinzen freigegeben)
- 1656-1680: Regierung von Johann Georg II. von Sachsen, entwickelte den absolutistischen Herrschaftsstil weiter, gab spektakuläre Hoffeste, errang keine wesentliche außenpolitische Erfolge, langsamer wirtschaftlicher Wiederaufschwung nach dem Dreißigjährigen Krieg, zu diesem trugen die aus Böhmen und Frankreich eingewanderten gewerbefleißigen Exulanten wesentlich bei, 1662: bedeutende Silberfunde bei Johanngeorgenstadt, 1666: Beginn der Damastproduktion in Großschönau (Oberlausitz), 1674: Gründung der Dresdner Seidenmanufaktur
- 1680-1691: Regierung von Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen (seit 1663 an der Landesregierung beteiligt, war ab 1672 Landvogt der Oberlausitz), reorganisierte die Landesverwaltung, schränkte die Hofhaltung ein, investierte mehr Geldmittel in das sächsische Heer, 1682: Aufbau des ersten stehenden Heeres Sachsens, Durchsetzung der Prinzipien des Absolutismus auch auf militärischem Gebiet
- 1683: Sieg über die Türken vor Wien unter wesentlicher Beteiligung des sächsischen Heeres unter Führung des Kurfürsten (sächsische Truppen waren noch bis zur Eroberung Belgrads 1788 an den Türkenkriegen beteiligt), ab 1688: Dritter Reunionskrieg, der Kurfürst kämpfte mit seinen Truppen am Rhein im Reichsheer (übte 1691 dessen Oberbefehl aus) gegen Frankreich (auch Kurprinz Friedrich August nahm an mehreren dieser Feldzüge gegen Frankreich teil)
- 1691-1694: Regierung von Johann Georg IV., 1693: Teilnahme am Reichskrieg gegen Frankreich, wurde nach nur dreijähriger Herrschaft Opfer einer Blattern-Epidemie
1694-1763: August der Starke, Barock, Friedrich August II., Siebenjähriger Krieg

Bild: Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen (August der Starke) - zugleich König August II. von Polen (Ausschnitt aus einem Gemälde von Louis de Silvestre, Gemäldegalerie Alte Meister Dresden)
- 1694-1763: "Augusteisches Zeitalter", Regierung der kunstsinnigen Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen (August der Starke; 1670-1733; reg. 1694-1733) und Friedrich August II. von Sachsen (1696-1763, reg. 1733-1763) als absolutistische Herrscher (nach dem Vorbild Ludwig XIV. von Frankreich), pompöse barocke Hofhaltung, prächtige Barockbauten und -gärten, opulentes Dresdner Kunstleben, Aufbau der überaus wertvollen Dresdner Kunstsammlungen, die Residenzstadt Dresden wurde zur Kunstmetropole von europäischem Rang, gefestigte Einheit und Autorität des Staates im Absolutismus, neue zentrale Behörden, ein mit Bürgerlichen besetzter Beamtenapparat, General-Konsumtionsakzise (machte den Kurfürsten von den Ständen finanziell unabhängig), Förderung des Manufakturwesens (v.a. durch den enormen Bedarf des sächsischen Hofes an Repräsentationsmitteln und repräsentativer Architektur), große Perspektiven für das Bürgertum, Schwächung der Stände und der adligen Kräfte
- 1697: Friedrich August I. (August der Starke) wechselte im Bestreben um die vakante polnische Krone zum Katholizismus (zunächst unter Geheimhaltung), Sachsen verlor hierdurch die Führungsrolle unter den evangelischen Reichsständen an Brandenburg-Preußen, der Glaubenswechsel entfremdete den Landesherren von seinen evangelischen Untertanen, die Funktion des Oberhauptes der evangelischen Landeskirche in Sachsen wurde dem Geheimen Rat übertragen, später agierte das Oberkonsistorium weitgehend selbstständig (nominell blieben die katholischen Kurfürsten und Könige von Sachsen bis 1918 Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und "Hüter des Protestantismus")
- 26./27. Juni 1697: Wahl Friedrich Augusts I. in Warschau zum König von Polen, 15. September 1697: Krönung als König August II. von Polen in Krakau, aus der sächsischen Staatskasse flossen Unsummen an Bestechungsgeldern an den Adel und kirchliche Würdenträger Polens, in der Zeit der Abwesenheit des Kurfürsten fungierte der schwäbische Reichsfürst Anton Egon Fürst zu Fürstenberg als Statthalter in Sachsen
- 1700: Beginn des um die Vorherrschaft im Ostseeraum geführten Nordischen Krieges, als polnischer König sah sich August der Starke zur Beteiligung gezwungen (1698 hatte er mit Zar Peter I. von Rußland bei Lemberg ein Abkommen geschlossen, gemeinsam mit Dänemark die Vormachtstellung Schwedens im Ostseeraum zu brechen, Polen wollte das 1660 von den Schweden eroberte Livland zurückgewinnen), Niederlage der Russen bei Narwa, 1702: Niederlage des sächsisch-polnischen Heeres bei Klissow (nördlich von Krakau) und 1704 bei Pultusk, König Karl XII. von Schweden ließ Stanislaus Leszczynski zum Gegenkönig von Polen ausrufen, 1706: vernichtende Niederlage des sächsisch-polnischen Heeres bei Fraustadt, Besetzung Kursachsens durch die Schweden, Frieden von Altranstädt, Friedrich August I. verlor die polnische Krone und musste das Bündnis mit Rußland auflösen
- 1709: Sieg des Zaren Peter I. über die Schweden bei Poltawa, Besetzung Polens durch die sächsische Armee, 1716: Friedrich Augusts I. erlangte die polnische Krone zurück, 1721: Frieden von Nystadt, Ende des Nordischen Krieges, Sachsen hatte anders als Brandenburg-Preußen und die neue Großmacht Rußland keinen Vorteil gewonnen (nicht einmal eine Landverbindung zwischen Sachsen und Polen)
- Neugründung zahlreicher bedeutender Manufakturen, allmähliche Wiederherstellung der früheren Wirtschaftskraft Sachsens, 1710: Gründung der Königlichen Porzellan-Manufaktur (1709 hatten Johann Friedrich Böttger, Ehrenfried Walther von Tschirnhaus und Freiberger Hüttenleute das europäische weiße Porzellan erfunden), Verlegung der Manufaktur aus Geheimhaltungsgründen in die Meißner Albrechtsburg
- 1711 (nach dem Tod von Kaiser Joseph I.): August der Starke übte bis zur Wahl des neuen Kaisers das mit der sächsischen Kurwürde verbundene Amt des Reichsvikars aus, eigene Bestrebungen um die Kaiserwürde musste er aufgeben, 1712: Wechsel des sächsischen Kurprinzen zum Katholizismus (erst 1717 offiziell bekannt gegeben, löste große Empörung am Hofe und im Lande aus, auch bei der Gemahlin Augusts des Starken, Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth, sie betrat auch niemals polnischen Boden)
- 20. August 1719: pompöse Hochzeit des sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. mit Maria Josepha (Tochter des verstorbenen Kaisers Joseph I.) in Wien, es erwuchsen Aussichten für den Kurprinzen auf die Kaiserkrone, August der Starke schloss Bündnisse mit Österreich, England und dem Kurfürstentum Hannover gegen die erstarkenden Mächte Rußland und Brandenburg-Preußen, 1722: Verschärfung des Zollkrieges mit Brandenburg-Preußen, 1724: Ablösung der "Konstitutionen" von 1572 durch den "Codex Augusteus", 1728: eine neue Landtagsordnung schränkte die Rechte der Stände weiter ein
- Entwicklung der Residenzstadt Dresden zu einer der prächtigsten Städte Europas, Wirken bedeutender Künstler aus vielen Ländern Europas am sächsischen Hof, 1705: Gründung der Malerschule (Ursprung der Dresdner Kunstakademie), öffentlich zugängliche Museen, Entwicklung der Dresdner Kunstsammlungen (Porzellansammlung, Pretiosensammlung/"Grünes Gewölbe", Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, Münzkabinett und Mathematisch-Physikalischer Salon/Sammlung der Instrumentenkunst) zu den reichsten Kunstsammlungen Europas und der Dresdner Antikensammlung (Sammlung antiker Skulpturen) zur größten Sammlung nördlich der Alpen, Wirken ausgezeichneter Barockbaumeister wie Klengel, Pöppelmann (Dresdner Zwinger 1711-1728), Knöffel, Longuelune und de Bodt in Dresden, 1726-1743: Bau der Dresdner Frauenkirche durch Ratszimmermeister George Bähr
- 1730: Zeithainer Lager als Abschluss und Höhepunkt der Augusteischen Heeresreform, von großartigen Festlichkeiten begleitete Manöver in Anwesenheit von König Friedrich Wilhelm I. von Preußen und weiteren 47 Fürsten
- 1733: Tod Augusts des Starken in Warschau, 1734: Beisetzung in der Kathedrale des Schlosses Krakau (sein Herz wurde in einer silbernen, innen vergoldeten Kapsel zunächt in der alten katholischen Kapelle zwischen Schloss und Taschenbergpalais in Dresden und dann in einer Mauernische der Königsgruft der 1755 fertig gestellten Katholischen Hofkirche beigesetzt)
- 1733-1763: Regierung von Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen (Sohn Augusts des Starken), 1734: Krönung als König August III. von Polen in Krakau
- starke Erweiterung der Dresdner Gemäldegalerie zu einer der bedeutendsten Gemäldesammlungen Europas (unter August dem Starken waren dagegen die Porzellansammlung und das "Grüne Gewölbe" besonders gewachsen), Erwerb von Raffaels "Sixtinischer Madonna" (Hauptwerk der Galerie), führende Stellung des sächsischen Musiklebens in Deutschland, Entwicklung der italienischen Oper zu höchster Blüte, Entwicklung der Orgelbaukunst zur Vollkommenheit durch den in Freiberg tätigen Orgelbauer Gottfried Silbermann, 1723-1750: Wirken von Johann Sebastian Bach als Thomaskantor (Kantor der Thomaskirche) in Leipzig
- Leipzig entwickelte sich zu einem "Klein Paris" mit einem einzigartigen Zusammenwirken von Handel, Gelehrsamkeit und weltmännischer Bildung, Beginn der Kunstbewegung der deutschen Aufklärung an der Leipziger Universität, Reform des deutschen Theaters durch Johann Christoph Gottsched und die hochbegabte Schauspielerin Caroline Neuber
- Kurfürst Friedrich August II. hatte nur geringe politische Fähigkeiten und Ambitionen, die Regierungsgeschäfte wurden durch Graf Heinrich von Brühl (1700-1763) ausgeübt (ab 1746 sächsischer Premierminister), unglückliche Diplomatie, Vernachlässigung der militärischen Rüstung Sachsens, Günstlingswirtschaft, Korruption und persönliches Gewinnstreben zerrütteten die Staatsfinanzen
- 1740 (nach dem Tod Kaiser Karls VI.): Ansprüche des sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs auf die Kaiserkrone, Bündnis mit Preußen und Bayern gegen Österreich, 1740-1742: Erster Schlesischer Krieg, Preußen besetzte 1740 das österreichische Schlesien, Sachsen besetzte 1741 Böhmen und Mähren, 1742: Frieden von Breslau, Preußen erhielt Schlesien zugesprochen, Kursachsen ging leer aus, 1743: Bündnis Friedrich Augusts II. mit Österreich gegen Preußen (gegen den ehrgeizigen und wagemutigen jungen König Friedrich II. von Preußen - Friedrich den Großen), 1744-1745: Zweiter Schlesischer Krieg, Kursachsen kämpfte mit Österreich, England/Hannover und Rußland gegen Preußen, erstrebte die Rückgewinnung Magdeburgs und eine Landbrücke nach Polen, 1745: Siege der Preußen bei Hohenfriedeberg und bei Kesselsdorf, alle Hoffnungen Sachsens auf Landgewinn zerschlugen sich
- 1756-1763: Siebenjähriger Krieg, Einmarsch preußischer Truppen in das militärisch weit unterlegene Sachsen, Kapitulation der sächsischen Armee schon in den ersten Kriegswochen, Kursachsen kam unter preußische Verwaltung, Friedrich August II. und Graf Brühl flohen nach Warschau, 1759: Aufgabe Dresdens durch die preußischen Besatzer nach einer schweren Niederlage gegen ein österreichisch-russisches Heer bei Kunnersdorf, Kapitulation des preußischen Generals Fink bei Maxen, 1760: erfolglose Belagerung Dresdens durch die Preußen, Zerstörung großer Teile der Altstadt durch Artilleriebeschuss, Sieg der Preußen bei Torgau, besetzten wieder den größten Teil Sachsens, 1763: Frieden von Hubertusburg zwischen den kriegsmüden Parteien, die politischen Errungenschaften der Augusteischen Zeit waren zunichte geworden und Sachsen wirtschaftlich ruiniert, Verlust der polnischen Königskrone, Zerfall der sächsisch-polnischen Union, Ende des Augusteischen und des Barock-Zeitalters in Sachsen, Kursachsen spielte im kommenden Kräftespiel zwischen Österreich und Preußen keine entscheidende Rolle mehr
- 1763: Tod Friedrich August II. und des Staatsministers Graf Brühl, Tod des Nachfolgers Friedrich Christian schon nach wenigen Wochen Regierungszeit durch Erkrankung an den Pocken
1763-1806: Kurfürst Friedrich August III., Rokoko, Klassizismus
- 1763-1827: Regierung von Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen (Friedrich August der Gerechte, bis 1768 unter Vormundschaft von Prinz Xaver, ab 1806 als König Friedrich August I. von Sachsen), Staatsreform, Beginn der Neuordnung der zerrütteten Staatsfinanzen (Staatskredit 1789 wieder hergestellt, Staatsschulden 1806 nahezu getilgt) und der Wiederbelebung (Rétablissement) der sächsischen Wirtschaft, Reorganisation des Heeres nach preußischem Vorbild, Sparmaßnahmen des kurfürstlichen Hofes (u.a. Schließung der Oper, Auflösung des Balletts), Berufung fähiger Leute (z.B. Thomas von Fritsch, Graf Flemming, Graf Einsiedel) in die Regierung, Beseitigung feudaler Privilegien, Stärkung der Bürgerrechte, Gründung zahlreicher neuer Manufakturen (z.B. in Plauen, Crimmitschau und Chemnitz)
- 1764: Gründung der Kunstakademien in Dresden (nach Plänen von Christian Ludwig Hagedorn) und Leipzig zur Förderung von Wissenschaft, Kunst und des Manufakturwesens, 1765: Eröffnung der Bergakademie in Freiberg (erste montanwissenschaftliche Lehranstalt der Welt), 1764: Gründung der "Leipziger ökonomischen Sozietät" zur Förderung der landwirtschaftlichen und gewerblichen Produktion durch die Einführung neuer Techniken, aber Missernten wie im Jahr 1771 führten noch immer zu Hungersnöten
- Kurfürst Friedrich August III. agiert sehr selbstbewusst und konservativ, konnte jedoch nicht alle vom Bürgertum angestrebten Neuerungen in den politischen und wirtschaftlichen Strukturen Sachsens verhindern, außenpolitisch auf Neutralität und Reichstreue bedacht (sah in der Reichsverfassung den Garant für die Unversehrtheit kleinerer Staaten gegen Übergriffe der europäischen Großmächte wie Österreich und Preußen)
- 1778/79: Bayrischer Erbfolgekrieg (nach dem Tod des letzten bayrischen Wittelsbachers Max Joseph), Kaiser Joseph II. besetzte Bayern, auch Kursachsen machte Ansprüche auf Bayern geltend, Sieg Preußens (mit Sachsen im Bündnis) über die Österreicher, Teschener Frieden, Kursachsen übernahm die (ehem. böhmische) Lehnshoheit über die Schönburger Besitzungen (hatten am längsten ihre Souveränität gegenüber den sächsischen Kurfürsten behaupten können), 1785: Gründung des Deutschen Fürstenbundes (Preußen, Hannover und Kursachsen) gegen die Expansionsbestrebungen Kaiser Josephs II.
- 1790: Bauernaufstand (ausgehend von der Lommatzscher Pflege) wegen der Missstände in der Landwirtschaft und der unerträglichen Frondienste, der Kurfürst versprach die Abstellung der gröbsten Missstände, gewaltsames Vorgehen des sächsischen Militärs in einigen Orten wie Rochlitz, 1790: Ausstand Freiberger Bergleute aus Protest gegen Hungerlöhne und Wucher bei den Lebensmittelpreisen
- 1791: Treffen in Schloss Pillnitz: Kaiser Leopold II., König Friedrich Wilhelm II. von Preußen und der französische Graf von Artois (später König Karl X. von Frankreich) beschlossen Maßnahmen gegen das revolutionäre Frankreich (Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen war nur Gastgeber des Pillnitzer Treffens), 1792: Beschluss des Reichskrieges gegen Frankreich durch den Immerwährenden Reichstag in Regensburg, Kursachsen nahm nur als Reichsstand teil (war vor allem an den Kämpfen bei Mainz und Kaiserslautern beteiligt), 1797 Ende des Ersten Koalitionskrieges, Frankreich gewann die linksrheinischen Gebiete, 1798-1801: Zweiter Koalitionskrieg, Kursachsen und Preußen wahrten Neutralität, Frankreich blieb siegreich, 1803: Regensburger Reichsdeputationshauptschluss, Entschädigung der deutschen Fürsten für ihre verlorenen linksrheinischen Gebiete mit Territorien der geistlichen Fürstentümer, der Reichsritterschaft und der Reichsstädte (Neuordnung des deutschen Reichsgebietes und Auflösung der Reichsverfassung)
1806-1827: Napoleonische Kriege, Sachsen wird Königreich, König Friedrich August I.
- Gründung des Napoleonischen Kaiserreiches unter Kaiser Napoleon I. und 1804 des österreichischen Kaiserreiches unter Kaiser Franz I., 1806: Gründung des Rheinbundes durch Napoleon, Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die nun eigenständigen norddeutschen Staaten (auch Preußen) wurden zur Beute der Napoleonischen Eroberungspolitik, Kursachsen gab seine Neutralität auf und verbündete sich mit Preußen, 1806: Schlacht bei Saalfeld, Niederlage der preußisch-sächsischen Armee gegen Napoleon, vernichtende Niederlage gegen Napoleon bei Jena und Auerstedt, Besetzung des Kurfürstentums Sachsen durch französische Truppen
- 1806: Friedensvertrag von Posen, Beitritt Sachsens zum Rheinbund, Kaiser Napoleon erhob Sachsen zum Königreich, 20. Dezember 1806: Friedrich August III. als König Friedrich August I. von Sachsen ausgerufen, Sachsen stellte Napoleon ein Kontingent von 20.000 Soldaten aller Waffengattungen, Verzicht Frankreichs auf Kriegskontributionen
- die ständische Verfassung und die alten Verwaltungsstrukturen blieben in Sachsen unverändert (wurden dagegen in Preußen tiefgreifend reformiert), protestantische und katholische Gottesdienste wurden einander gleichgestellt, katholische Gemeindekirchen entstanden, 1807: königliches Dekret über die Freiheit der Religionsausübung, enorme Belebung der sächsischen Wirtschaft infolge Napoleons Kontinentalsperre, die England als Konkurrent ausschaltete
- 1807: Sieg der französischen über die preußischen Truppen, Frieden von Tilsit, Sachsen verlor die altangestammten Gebiete Gommern, Barby und Mansfeld, gewann aber den Cottbuser Kreis, einige Lausitzer Gebiete und die Verwaltung des Herzogtums Warschau, diese Maßnahmen sorgten für neue Spannungen zwischen Sachsen und Preußen, 1809: Kampf sächsischer Truppen an der Seite Napoleons gegen Österreich (Schlacht bei Wagram), Besetzung Westsachsens bis nach Dresden durch österreichische Truppen, Flucht des sächsischen Königs nach Frankfurt/Main, aber noch im selben Jahr Sieg Napoleons über Österreich, Napoleon fügte Krakau und das bisher österreichische Neu-Galizien dem sächsisch verwalteten Herzogtum Warschau hinzu und erhob dieses zum Großherzogtum
- 1812: Teilnahme Sachsens mit 21.000 Soldaten am Feldzug gegen Rußland, Frühjahr 1813: Rückkehr von nur wenig mehr als eintausend Soldaten aus Rußland, Übergreifen der Befreiungskriege gegen Napoleon auf das Königreich Sachsen, dieses wurde zum Hauptkriegsschauplatz, Vordringen von Kosaken in die Lausitz, Flucht des sächsischen Königs über Plauen, Regensburg und Linz nach Prag, Einmarsch russischer Truppen in Dresden, außer Napoleon Bonaparte weilten nun auch Zar Alexander I. von Rußland und König Friedrich Wilhelm II. von Preußen in Sachsen, enorme Schäden und Verluste, große Not der Bevölkerung, zehntausende militärische und zivile Opfer, verheerende Seuchen
- Sieg Napoleons bei Lützen, französische Besetzung Dresdens, Rückkehr des sächsischen Königs, Brandvernichtung der Stadt Bischofswerda beim Vormarsch der Franzosen auf Bautzen, Sieg Napoleons in der Schlacht bei Bautzen, Rückzug der antinapoleonischen Alliierten nach Schlesien
- ab August 1813: Wiedereinrücken der Verbündeten in Sachsen, Napoleon sammelte seine Truppen bei Leipzig (unter Anwesenheit von König Friedrich August I.), 16.-19. Oktober 1813: Völkerschlacht bei Leipzig (erste Massenschlacht der Neuzeit), Überlaufen sächsischer Truppen zu den Alliierten, Gefangennahme des sächsischen Königs (als Kriegsgefangener nach Berlin gebracht), 11. November 1813: Kapitulation der französischen Garnison Dresden
www.grenadierbataillon-von-spiegel.de
Verein zur Erforschung der sächsischen Militär-Geschichte, v. a. zur Zeit der Befreiungskriege
www.napoleonstrasse1813.de- das Königreich Sachsen wurde preußisch-russisches Generalgouvernement (Generalgouverneur bis 1814 war der russische Fürst Repnin-Wolkonski, stieß längst überfällige politische, wirtschaftliche und kulturelle Reformen an), Aufstellung des "Banners der freiwilligen Sachsen" gegen Napoleon (u. a. an der Belagerung von Mainz beteiligt), Beteiligung eines sächsischen Heeres unter General Johann Adolph von Thielmann an der Schlacht bei Waterloo 1815 und an der Besetzung Frankreichs, Beseitigung der ärgsten Kriegsschäden in Sachsen, Weiß-Grün wurden die neuen Landesfarben Sachsens, 1815: Rückkehr des Königs, er machte viele Reformen rückgängig
- 1815: Wiener Kongress, das Königreich Sachsen erfuhr (im Gegensatz zu anderen Rheinbundstaaten) - vor allem auf Betreiben Preußens - keine Schonung, verlor etwa 58% seines Territoriums und 42% seiner Einwohner an das Königreich Preußen (Sachsen wurde zum kleinsten Königreich Deutschlands), an Preußen fielen die Niederlausitz, der östliche Teil der Oberlausitz (unter Aufhebung der böhmischen Erbansprüche), Teile der Kreise Leipzig und Meißen, der Thüringische Kreis und der Kurkreis Wittenberg (die neue Grenzlage blieb bis 1945 bestehen), das Großherzogtum Warschau fiel als "Kongresspolen" an Rußland
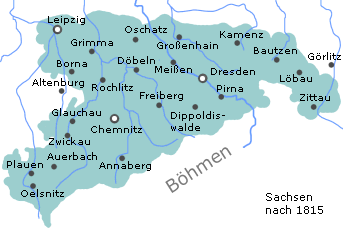
Bild: Sachsen nach 1815
- 1815: Auflösung des Generalgouvernements Sachsen, die sächsische Geschichte ist nun im wesentlichen nur noch eine Wirtschafts- und Kulturgeschichte, Beitritt zum Deutschen Bund (hatte die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und die Souveränität der Mitgliedsstaaten zum Ziel), Sachsen musste eine landständische Verfassung einführen, gleiche Rechte und Pflichten für alle christlichen Konfessionen garantieren, die Lage der Juden verbessern und allen Einwohnern des Bundes vereinheitlichte Rechte einräumen (z. B. freier Erwerb von Grundeigentum, Reisefreiheit, Zivil- und Militärdienste in einem beliebigen Bundesstaat)
1827-1904: Bürgerliche Reformen, Sächsische Verfassung, Industrialisierung
- 1827-1836: Regierung von König Anton von Sachsen, das Königreich Sachsen sperrte sich (vor allem durch das Wirken des reaktionären Ministers Detlev von Einsiedel) noch lange gegen längst überfällige Reformen, 1830: Unruhen in Leipzig und Dresden, zwangen den König zur Anerkennung von bürgerlichen Reformen und einer sächsischen Verfassung (4. September 1831), diese beschnitt die Rechte des Königs und die Vorrechte der Stände und räumte den Bürgern ein (beschränktes) Wahlrecht ein, Übergang der Kunstsammlungen und zahlreicher sächsischer Schlösser in Staatseigentum, Finanzierung des sächsischen Staates und des königlicheb Hofes nun getrennt, Auflösung des Geheimen Kabinetts, der nun aus zwei Kammern bestehende Landtag repräsentierte die einflussreichsten bürgerlichen und adligen Kräfte des Landes (nicht jedoch das Volk), Gliederung Sachsens in vier Kreisdirektionen (Dresden, Bautzen, Zwickau und Leipzig), Abschaffung der Fronpflicht und weiterer Lasten auf dem Land
- 1836-1854: Regierung von König Friedrich August II. von Sachsen, 1848: revolutionäre Bewegung für ein vereinigtes demokratisches Deutschland auch in Sachsen, Abdankung des reaktionären Ministers Traugott von Könneritz, Bildung der ersten bürgerlichen Regierung Sachsens, sächsische Landtagswahlen (in beiden Kammern siegten die Demokraten), aus dem "Musterland der Reaktion" wurde ein "Rotes Königreich", 1849: Dresdner Maiaufstand (nach der Ablehnung der Frankfurter Paulskirchenverfassung und der Auflösung des sächsischen Parlaments durch den König), von sächsischen und preußischen Truppen niedergeschlagen, 1850: Wiedereinrichtung der alten Landstände, die politischen Reformen erlitten herbe Rückschläge
- ab 1825: Gründerzeit (viele neue Firmen und Banken entstanden), Beginn einer rasanten Industrialisierung Sachsens (allein etwa 200 Fabrikgründungen durch die Textilindustrie bis 1830 v. a. im Erzgebirgsvorland, im Vogtland und in der südlichen Oberlausitz), 1829: Gründung des "Sächsischen Industrievereins", 1834: Beitritt zum Deutschen Zollverein (wurde bald von Sachsen ökonomisch dominiert), große Fortschritte im Verkehrswesen (1836-1839: Bau der ersten deutschen Eisenbahn-Fernverkehrsstrecke Leipzig-Dresden, 1837: Beginn der regelmäßigen Elbe-Dampfschifffahrt), Beginn des Tourismus im Elbtal und im Elbsandsteingebirge
- 1854-1873: Regierung von König Johann von Sachsen, Sprachwissenschaftler und ausgebildeter Jurist, kunstsinnig und an den Wissenschaften interessiert (Dante-Forscher und Übersetzer von Dantes "Göttlicher Komödie"), gehörte ca. 30 europäischen wissenschaftlichen Gesellschaften an, außenpolitisch operierte er weniger glücklich
- 1866: Sieg Preußens in der Schlacht bei Königgrätz über Österreich (und dessen Verbündeten Sachsen), Sachsen musste Bismarcks Norddeutschem Bund beitreten, Bismarck vermochte Sachsen innerhalb kurzer Zeit in das preußische politische System zu integrieren, 1870/71: Deutsch-Französischer Krieg, Sachsen stellte die Maas-Armee, Beteiligung sächsischer Truppen an der Niederschlagung der Pariser Kommune und an der Annexion von Elsaß-Lothringen, französische Kontributions-Gelder wurden für den Bau und die Restaurierung repräsentativer Gebäude in Dresden (z. B. Finanzministerium und Gesamtministerium) und anderen sächsischen Städten (z. B. Meißner Albrechtsburg) verwendet, Prinz Albert von Sachsen wurde Marschall des Deutschen Reiches, der sächsische General Georg Friedrich von Fabrice Generalgouverneur im besetzten Frankreich
- 1873-1902: Regierung von König Albert von Sachsen, 1902-1904: Regierung von König Georg von Sachsen
- um 1895: Übergang von der Waren- zur Mustermesse in Leipzig, die Stadt war im Rauchwarenhandel (Pelzhandel) führend in Deutschland, zweite Phase der Industrialisierung, enormes Bevölkerungswachstum in den sächsischen Städten und Gemeinden mit Industriestandorten, Bau repräsentativer Gebäude in historisierenden Neo-Stilen (wie Neogotik, Neorenaissance und Neobarock) in den Stadtzentren, Bau großer trister Mietskasernen an den Stadträndern, unerträgliche Arbeitsbedingungen, Hungerlöhne, Kinderarbeit, Verelendung der Arbeiter bei Krankheit und im Alter, Sachsen wurde Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie, 1863: Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Leipzig durch Ferdinand Lassalle, 1903: Höhepunkt des Arbeitskampfes, Streiks in Crimmitschau (einem Zentrum der Textilindustrie), Sieg der SPD in 22 von 23 sächsischen Wahlkreisen (nur Bautzen wählte konservativ)
1904-1945: Ende der Monarchie, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg
- 1904-1918: Regierung von König Friedrich August III. von Sachsen (letzter sächsischer König), galt als konservativ und konfliktscheu, 1914: 750.000 sächsische Soldaten zogen in den Ersten Weltkrieg (1914-1918), 229.000 fielen
- November 1918: Gründung eines sächsischen Arbeiterrates in Leipzig und eines sächsischen Soldatenrates in der Fliegerkaserne Großenhain, Ausbreitung der Novemberrevolution über ganz Sachsen, 10. November 1918: Ausrufung der Republik (im Zirkus Sarrasani in Dresden), 13. November 1918: Abdankung des Königs (war in das bei Ruhla gelegene Schloss Guteborn geflüchtet, zog sich nach Sibyllenort bei Breslau zurück)
- 1919: Wahlen zur Sächsischen Volkskammer, erstmals in Sachsen auch Frauen wahlberechtigt, Februar/März 1919: Generalstreik im Leipziger Raum und im April 1919 im Zwickauer Steinkohlerevier, sächsischer Kriegsminister Gustav Neuring von aufgebrachten Kriegsgeschädigten nach einer öffentlichen Rede in der Elbe ertränkt, Verhängung des Belagerungszustandes über Sachsen, Einmarsch der Reichswehr, März 1920: Flucht der Reichsregierung vor den Kapp-Putschisten nach Dresden, Straßenkämpfe in Dresden und Leipzig
- 1920: neue sächsische Verfassung (orientierte sich an der Weimarer Verfassung), Zeit der Weimarer Republik: Sachsen war Freistaat mit einem Parlament und einem Ministerpräsidenten
- 1923: Bildung einer sächsischen Linksregierung (u. a. wegen der enormen Verschlechterung der Wirtschaftslage), Einmarsch der Reichswehr zum Sturz der Linksregierung ("Reichsexekution"), dieser Verfassungsbruch brachte das Kabinett Stresemann zu Fall
- 1932: Beisetzungsfeierlichkeiten für den letzten sächsischen König in Dresden mit hunderttausenden Trauergästen
- 1929: Weltwirtschaftskrise, die exportstarke sächsische Wirtschaft war besonders hart betroffen, überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit, 1933: Reichstagswahlen, die NSDAP erhielt außerordentlich viele Stimmen in Sachsen, Machtantritt der Nationalsozialisten, 30. Januar 1934: Auflösung des sächsischen Landtages, Ende des Freistaates Sachsen, Internierung politischer Gegner in Sachsen u. a. in den Zuchthäusern Bautzen und Waldheim und im Militärgefängnis Torgau, Euthanasiemaßnahmen in Bernburg und Pirna-Sonnenstein (Tötung zehntausender behinderter Menschen), Bau kleinerer Konzentrationslager in Sachsens (u. a. Burg Hohnstein, Offizierslager Festung Königstein und Festung Colditz), 1938: Massendeportationen sächsischer Juden - beginnend in Leipzig (hier lebten 15.000 von insgesamt 23.000 sächsischen Juden), Reichstagsbrandprozess im Leipziger Reichsgericht (der bulgarische Kommunist Georgi Dimitroff errang einen vielbeachteten juristischen Sieg gegen die Nazi-Ankläger), 1943/44: Leipziger Schumann-Engert-Kresse-Gruppe agierte als eine der aktivsten Widerstandsgruppen Deutschlands
- Ende des Zweiten Weltkrieges: englisch-amerikanische Bombenangriffe legten zahlreiche sächsische Städte in Schutt und Asche (z. B. Leipzig im Dezember 1943, Bombardierungen von Chemnitz und Plauen in den letzten Kriegswochen, systematische Zerstörung Dresdens am 13./14. Februar 1945)
ab 1945: Nachkriegszeit, DDR, Freistaat Sachsen
- 25. April 1945: Zusammentreffen der vorrückenden sowjetischen und amerikanischen Truppen an der Elbe bei Torgau, Mai/Juni 1945: Fluss Mulde zum Grenzfluss zwischen dem sowjetisch und dem amerikanisch besetzten sächsischen Gebiet erklärt, wenig später Abzug der amerikanischen Truppen aus den sächsischen und thüringischen Territorien (laut Vereinbarung der Siegermächte)
- November 1945: Bodenreform, etwa ein Achtel der landwirtschaftlichen Nutzfläche Sachsens (1.212 Güter mit 260.000 ha Land) enteignet und an Neubauern vergeben, Übergang der großen deutschen Unternehmen und des Eigentums der aktivsten Nationalsozialisten in die Verfügungsgewalt der Alliierten (laut dem Potsdamer Abkommen), Mai 1946: Übertragung der enteigneten Güter und Betriebe an die Landesverwaltungen der sowjetischen Besatzungszone (einige große Unternehmen blieben in sowjetischer Hand, z. B. die 1945 als sowjetische Aktiengesellschaft gegründete SDAG Wismut für den Uranerzbergbau)
- Übergang bedeutender Kulturgüter der zahlreichen sächsischen Schlösser und Herrensitze in die staatliche Verwaltung (auch von Gutsarchiven und bedeutenden Schlossbibliotheken), viele Kunstgegenstände wechselten in den Bestand der Dresdner Kunstsammlungen und anderer sächsischer Museen
- August 1946: "Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung" in Dresden, 20. Oktober 1946: Landtagswahl in Sachsen, knappe Mehrheit für die aus der Vereinigung von SPD und KPD hervorgegangene SED (zusammen mit der Bauernhilfe und dem Kulturbund), Dr. Rudolf Friedrichs zum ersten sächsischen Ministerpräsidenten der Nachkriegszeit gewählt, 28. Februar 1947: neue sächsische Verfassung
- umfangreiche Reparationsleistungen der ostdeutschen Länder an die Sowjetunion (anders als bei den vom Marshallplan profitierenden westdeutschen Ländern), Abtransport von Verkehrseinrichtungen (z. B. Bahngleisen) und ganzer Industriebetriebe, massenhafte Ablieferung von Erzeugnissen der wieder anlaufenden Produktion (auf Sachsen entfielen die höchsten Reparationsleistungen aller ostdeutschen Länder)
- 1949: Gründung der DDR, 6. Juli 1950: Abkommen zwischen der DDR und Polen über den Verlauf der Oder-Neiße-Grenze (von den Alliierten als neue deutsch-polnische Grenze bestimmt), Anfang der 50er Jahre: Waldheimer Prozesse (Todesurteile und Haftstrafen für 3.308 Naziverbrecher, aber auch Regimegegner der Nachkriegszeit), 1952: Sachsen in die Bezirke Dresden, Leipzig und Chemnitz aufgeteilt, Chemnitz hieß ab 1953 Karl-Marx-Stadt, 17. Juni 1953: Volksaufstand gegen die Staats- und Parteiführung der DDR, von sowjetischen Truppen niedergeschlagen
- 1955: Rückkehr der im Krieg an 45 verschiedenen Orten ausgelagerten und nach dem Krieg in die Sowjetunion verbrachten Dresdner Kunstsammlungen (hatten in den Wirren der Nachkriegszeit herbe Verluste erlitten)
- Oktober 1989: Leipziger Demonstrationen für Meinungs- und Versammlungsfreiheit und die Zulassung oppositioneller Gruppen ("Montagsdemonstrationen"), Beginn der friedlichen Revolution, 1990: Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, 14. Oktober 1990: sächsische Landtagswahlen, die CDU errang die absolute Mehrheit, Kurt Biedenkopf zum ersten Ministerpräsidenten Sachsens nach der Wiedervereinigung gewählt
- 1991 bis 1994: Abzug der sowjetischen Truppen (340.000 Soldaten, 200.000 Zivilisten und 2,6 Mio. t Material sowie tausende Waffensysteme)
- 27. Mai 1992: neue sächsische Verfassung (Sachsen wurde wieder Freistaat), 1993: Kreisreform, Anzahl der sächsischen Kreise von 48 auf 23 verringert, sieben kreisfreie Städte, 1994: Landtagswahlen, die CDU errang wieder die absolute Mehrheit
- Sanierung unzähliger Baudenkmäler Sachsens, Wiederaufbau u. a. des Dresdner Schlosses und der Dresdner Frauenkirche, wachsende Bedeutung des Tourismus in Sachsen
 Angebot:
Angebot:CD-Ausgabe "Dresden & Umgebung"
mit 3 Büchern, 16 Fotogalerien und dem vollständigen landeskundlichen Reiseführer [ weiter... ]
nach oben
