
Landesgeschichte: Übersicht | Frühzeit | Deutsche Eroberung | Mark Meißen | Kurfürstentum Sachsen | Reformation, Kurfürst Moritz | Kurfürst August | Dreißigjähriger Krieg | August der Starke | Friedrich August III. | Napoleonische Zeit | Industrialisierung, Revolution | Ende Monarchie, Weltkrieg | Nachkriegszeit, DDR, Wende
Kulturgeschichte: Bildung & Wissenschaft | Buch- & Verlagswesen | Bildende Kunst | Musik & Tanz | Theater & Literatur

Kulturgeschichte in Stichpunkten
Bildung & Wissenschaft
- 1254: erste urkundliche Erwähnung einer sächsischen Stadtschule (der neben der Klosterschule bestehenden "Äußeren Schule" des Leipziger Thomasklosters), Entstehung weiterer Stadtschulen (Lateinschulen): z. B. in Dresden 1300, Zittau 1310, Bautzen 1331, Löbau 1359, Görlitz 1369, Freiberg 1382, Dippoldiswalde 1394 und Chemnitz 1399, Bedeutungsverlust der bisher dominierenden Klosterschulen mit dem Einzug der Reformation in Sachsen um 1535, Durchsetzung der humanistischen Bildung
- 1409: Gründung der Universität Lipsiensis (Leipzig) als sechste Universität im deutschen Reich (angeregt durch die von der tschechischen nationalistischen Bewegung aus Böhmen vertriebenen Studenten und Professoren der Prager Universität), um 1486: Wirken des Humanisten Konrad Celtis an der Universität Leipzig (Pflege des antiken Bildungs- und Wissenschaftserbes), 1514-1517: Wirken des Engländers Richard Crocus (erster offizieller Lehrer des Griechischen) an der Universität Leipzig, ab 1687: erste Vorlesungen in deutscher Sprache an der Universität Leipzig durch Christian Thomasius (1655-1728)
- 1502: Gründung der Landesuniversität Wittenberg durch Kurfürst Friedrich III. (als ernestinisches Gegenstück zu der auf albertinischem Gebiet gelegenen Universität Leipzig), hier lehrten auch Martin Luther (ab 1511) und Philip Melanchthon (ab 1518, führte 1528 eine neue Schulordnung im ernestinischen Teil Sachsens ein), 1543: Gründung der Landesschulen Meißen (St. Afra) und Pforta sowie 1550 der Landesschule Grimma durch Herzog Moritz (ab 1547 Kurfürst von Sachsen), finanziert durch die Auflösung von Kirchen- und Klostergütern im Zuge der Reformation, Vorbereitung begabter Schüler aus allen sozialen Schichten (im Notfall auch kostenlos) auf den Besuch der Universität (Heranbildung eines mit Bürgerlichen besetzten Verwaltungs- und Beamtenapparates für den Aufbau einer absolutistischen Herrschaft anstelle der bisherigen Adelsherrschaft)
- 1692: Gründung einer der ersten Kadettenschulen (Ausbildung des Offiziersnachwuchses) im deutschsprachigen Raum durch Kurfürst Johann Georg IV. von Sachsen
- 1724: neue Schulordnung in Kursachsen (u. a. Sommerschulen eingeführt), 1773-1781: Erneuerung der sächsischen Schulordnung durch Johann August Ernesti (Philologe und Theologe, ab 1734 Rektor der Leipziger Thomasschule), umfassende Reorganisation des gesamten höheren, mittleren und niederen Unterrichtswesens, insbesondere auch des Volksschulwesens, Einführung neuer Fächer wie Erdbeschreibung, Geschichte und Naturkunde, 1805: Verordnung "über das Anhalten der Kinder zur Schule und die Bezahlung des Schulgeldes betreffend" (Einzug der allgemeinen Volksschulpflicht in Sachsen), 1824: Eröffnung einer Dresdner Realschule als erste ihrer Art in Sachsen auf Betreiben von Justus Blochmann (langjähriger Mitarbeiter Pestalozzis), 1828: Einführung von Reifeprüfungen an den sächsischen Gymnasien
- 1758: Wiederentdeckung des Kometen Halley durch den in Prohlis bei Dresden lebenden Großbauern und "Hobby"-Astronomen Johann Georg Palitzsch (korrespondierendes Mitglied der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften, baute auch als einer der ersten die aus Amerika eingeführte Kartoffel in Sachsen an)
- ab 1774: Gründung bedeutender wissenschaftlicher Gesellschaften in Sachsen (z. B. 1774: Jablonowskische Gesellschaft zu Leipzig, 1779: Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz, 1784: Philologische Gesellschaft zu Leipzig, 1787: Naturforschende Gesellschaft zu Leipzig)
- 1778: Eröffnung des ersten deutschen Taubstummen-Instituts in Leipzig und des ersten deutschen Lehrerseminars für Volksschullehrer in Dresden-Friedrichstadt sowie 1809 der Dresdner Blindenanstalt, 1816-1822: Wirken von Samuel Friedrich Christian Hahnemann (Begründer der Homöopathie) an der Universität Leipzig, 1815: Eröffnung der Königlich-Sächsischen Chirurgisch-Medizinischen Akademie (ging aus der 1814 gegründeten Dresdner Lehranstalt für Medizin und Chirurgie hervor), 1816: Zusammenschluss der Ingenieur- und der Artillerieschule zur sächsischen Militärakademie
- 1816: Gründung der später weltbekannten Forstakademie Tharandt durch Heinrich von Cotta (1928 an die Technische Hochschule Dresden angeschlossen), 1822: Gründung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte auf Initiative von Carl Gustav Carus und Lorenz Oken
- 1825: Gründung des Königlich-Sächsischen Vereins zur Erforschung und Erhaltung vaterländischer Altertümer (Altertumsverein, machte sich um die Pflege kulturhistorischer Baudenkmäler Sachsens verdient), 1828: Gründung des Sächsischen Kunstvereins auf Initiative von Johann Gottlob von Quandt, 1881: Eröffnung der Albrechtsburg zu Meißen nach einer umfassenden Restaurierung durch den Altertumsverein (Vorsitzender war Prinz Georg von Sachsen) als Gedenkstätte für sächsische Geschichte, 1883: Herausgabe der "Beschreibenden Darstellung der älteren Kunstdenkmäler des Königreiches Sachsen" durch den Altertumsverein (Generalinventar aller bedeutenden kulturhistorischen Baudenkmäler Sachsens), 1896: Gründung der Königlich-Sächsischen Kommission für Geschichte (einer Einrichtung für landesgeschichtliche Forschung)
- 1828: Eröffnung der Technischen Bildungsanstalt Dresden in einem Pavillon auf der Brühlschen Terrasse (wo heute das Rietschel-Denkmal steht) durch Wilhelm Gotthelf Lohrmann unter Mitwirkung der bedeutenden Techniker und Erfinder Brendel, Blochmann und Schubert (ab 1852 Dresdner Polytechnikum, ab 1890 Technische Hochschule und ab 1961 Technische Universität Dresden)
- 1834: Eröffnung des sächsischen Hauptstaatsarchivs in Dresden, aus dem Archiv für sächsische Geschichte ging das Neue Archiv für sächsische Geschichte und Landeskunde hervor
- 1835: Volksschulgesetz, Einführung der allgemeinen Volksschule und der achtjährigen Schulpflicht in Sachsen, Verpflichtung der Gemeinden zum Unterhalt der Schulen, 1846: neue Schulordnung der sächsischen Gymnasien und 1860 der sächsischen Realschulen, Einführung eines umfassenderen naturwissenschaftlichen Unterrichts, 1850: Gründung eines Sportlehrerseminars in Dresden, 1858: neue Ordnung der nun zahlreichen sächsischen Lehrerseminare
- 1846: Gründung der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig auf Initiative des Mathematikers Moritz Wilhelm Drobisch (ab 1919 Sächsische Akademie der Wissenschaften), ab 1865: Entwicklung der Leipziger Universität zu einer der führenden Universitäten Deutschlands (v. a. in den Fachgebieten Medizin, Rechtswissenschaft und Philologie, ab 1853 erster deutscher Lehrstuhl für Augenheilkunde), 1927: Berufung von Werner Heisenberg an die Leipziger Universität, diese entwickelte sich zu einem Zentrum für Theoretische Physik in Deutschland
- 1897: Gründung des Vereins für sächsische Volkskunde durch Oskar Seyffert (Professor an der Königlichen Kunstgewerbeschule), leistete unter Seyfferts Leitung eine international beachtete wissenschaftliche und Museumsarbeit
- 1908: Gründung des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz (Arbeitsbereiche: Denkmalpflege, Naturschutz und Volkskunde), Herausgabe der Zeitschrift "Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz"
- 1913: Volksschulgesetz (Abschaffung des Religionsunterrichts an den sächsischen Schulen), 1921: Verabschiedung eines Gesetzes über die strikte Trennung von Kirchen- und Schuldienst der Volksschullehrer
- 1927: Eröffnung der Ausstellung "Die Technische Stadt" (zu deren Attraktionen das Kugelhaus gehörte) im Rahmen der Hundertjahrfeier der Technischen Hochschule Dresden, 1929: Eröffnung des Deutschen Hygienemuseums (anlässlich der II. Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden)
- 1933-1945 (Zeit des Nationalsozialismus): umfassende personelle Umstrukturierung der sächsischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen (im politisch stets sehr konservativen Land Sachsen setzte sich die Ideologie des Nationalsozialismus im Kunst- und Kulturleben noch konsequenter als anderswo in Deutschland durch), weitgehender Stillstand der Forschungs- und höheren Bildungstätigkeit (mit Ausnahme militärischer Arbeitsfelder) im Zweiten Weltkrieg, Zerstörung von etwa 85% der Bausubstanz der Technischen Hochschule Dresden durch die englisch-amerikanischen Bombenangriffe im Februar 1945 (ab 1946 provisorischer Lehrbetrieb mit nur 450 Studierenden an drei Fakultäten)
- 1949-1989 (Zeit der DDR): die sächsischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen gehörten zu den führenden der DDR, 1961: Erhebung der Technischen Hochschule Dresden zur Technischen Universität Dresden, Gründung des Dresdner Forschungsinstituts Manfred von Ardenne (eines der wenigen weitgehend staatsunabhängigen Institute der DDR, genoss internationalen Ruf)
- 1989/90: deutsche Wiedervereinigung, Neugründung des Freistaates Sachsen, 1990: Wiederbelebung des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz (war 1949 zwangsweise aufgelöst worden)
- ab 1990: massiver Personalabbau in den sächsischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen und umfassende Schulschließungen im ländlichen Raum aus Gründen der Kosteneinsparung, 1991: Sächsisches Hochschulerneuerungsgesetz, Schließung des Leipziger Instituts für Literatur, der Leipziger Deutschen Hochschule für Körperkultur (Sporthochschule) und der Landwirtschafts-Hochschule Meißen, Eröffnung der sächsischen Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Meißen, 1992: Schließung aller Fach- und Ingenieurschulen sowie Pädagogischen Hochschulen Sachsens, 1992: Hochschulstrukturgesetz, Erhalt von 4 Universitäten (Dresden, Leipzig, Chemnitz und Freiberg), 4 Kunsthochschulen (je zwei in Leipzig und Dresden) und 5 Fachhochschulen für Technik und Wirtschaft (Leipzig, Dresden, Mittweida, Zittau/Görlitz und Zwickau), Neugründung der Leipziger Handelshochschule (in freier Trägerschaft), 2001: Eröffnung des Meißner Landesgymnasiums St. Afra (vom Freistaat getragenes europa-offenes Gymnasium für Hochbegabte, erste Bildungseinrichtung dieser Art in den neuen Bundesländern), 2003: Gründung der Dresden International University (DIU, über Studiengebühren finanzierte private Elite-Universität)
Buch- & Verlagswesen
- zwischen 1230 und 1300: Herausgabe des "Sachsenspiegels" (bedeutendstes Rechtsbuch des Mittelalters) in der Mark Meißen
- um 1420: Johannes Tylich (wirkte an der juristischen Fakultät der Leipziger Universität) verfasste die Meißnische Chronica (Geschichte des Hauses Wettin), gehörte zu den ersten gedruckten sächsischen Büchern nach Einführung des Buchdruckgewerbes 1481 in Leipzig durch Marcus Brandis, ab 1491: Wirken von Melchior Lotter (einer der bedeutendsten Buchdrucker der Reformationszeit) in Leipzig, Entwicklung Leipzigs zur Buchstadt, 1594: erster Leipziger Büchermessekatalog (etwa 30 Jahre nach dem ersten Frankfurter Katalog)
- 1556: Zusammentragen (und gleichartiges Binden) zahlreicher Bücher in der Kurfürstlichen Bibliothek auf Weisung von Kurfürst August von Sachsen (Kurfürstliche Bibliothek zunächst im Residenzschloss in Dresden, dann im Zwinger und ab 1786 im Japanischen Palais untergebracht - ab 1788 öffentlich zugänglich - heute: Sächsische Landesbibliothek)
- 1569: Gründung der kursächsischen Bücherkommission (oberste Zensurbehörde Sachsens), 1590: Druck der Meißnischen Landchronik und der Meißnischen Bergchronik von Petrus Albinus in Dresden (erste sächsische Landes- und Bergbaugeschichte), ab 1619: Herausgabe der theosophischen Schriften des Mystikers Jakob Böhme (ab 1599 in Görlitz als Schuhmacher tätig)
- 1660: Herausgabe der "Leipziger Zeitung" (erste sächsische Zeitung), 1682: Herausgabe der Acta eruditorum von Otto Mencke (erste wissenschaftliche Zeitschrift Deutschlands) in Leipzig (erwarb sich schnell internationale Hochschätzung, in ihr publizierte ab 1684 auch der sächsische Gelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz)
- 1719: Eröffnung eines Leipziger Buch-, Kunst- und Musikverlages durch Bernhard Christoph Breitkopf (trug auch wesentlich zur Entwicklung des Notendrucks bei), 1732-1754: Herausgabe des 68-bändigen "Großen Vollständigen Universal Lexikons Aller Wissenschaften und Künste" (berühmtestes und meistbenutztes Lexikon seiner Zeit) im Verlag von Johann Heinrich Zedler in Halle/Leipzig, 1785: Gründung der Leipziger Verlagsbuchhandlung durch Georg Joachim Göschen, 1789: Gründung der Leipziger Verlags-, Sortiments- und Kommissionsbuchhandlung von Karl Franz Gottfried Koehler, 1811: Eröffnung des Verlages von Benedikt Gotthelf Teubner in Leipzig, 1812-1819: Herausgabe der zweiten Auflage des Konversationslexikons (wurde als der "Brockhaus" berühmt) des Leipziger Verlegers Friedrich Arnold Brockhaus
- 1825: Gründung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Leipzig (machte die Stadt zum Zentrum des deutschen Buchhandels), 1828: Eröffnung der Leipziger Verlagsbuchhandlung und Druckerei von Anton Philipp Reclam
- 1839: Erscheinen des "Anzeigers" als Dresdner Amtsblatt, 1853-1944: Herausgabe der in ganz Deutschland beliebten Leipziger Unterhaltungszeitschrift "Die Gartenlaube"
- 1848: Einführung der Pressefreiheit in Sachsen
- 1874: Wechsel des Bibliographischen Instituts von Hildburghausen nach Leipzig, Herausgabe von "Meyers Großem Konversationslexikon" in dritter Auflage, 1887: Herausgabe der Zeitschrift "Der Kunstwart" durch Schriftsteller Ferdinand Avenarius in Dresden (trug wesentlich zur ästhetischen Volkserziehung in Deutschland bei)
- 1912: Gründung der Deutschen Bücherei in Leipzig, 1914: Veranstaltung der I. Weltausstellung für Buchgewerbe und -graphik in Leipzig, 1922: Gründung der Leipziger Büchergilde Gutenberg als gewerkschaftliche Buchgemeinschaft, Herausgabe von Meyers Lexikon in 12 Bänden (7. Auflage) durch das Bibliographische Institut Leipzig, 1929: Herausgabe des Großen Brockhaus
- 1933-1945 (Zeit des Nationalsozialismus): Bücherverbrennungen auch in Sachsen (z. B. auf dem Wettiner Platz in Dresden)
- 1949-1989 (Zeit der DDR): Leipzig als Zentrum des Verlags- und Buchwesens der DDR (Sitz vieler Verlage und des zentralen Buchversandhandels)
- 1996: Vereinigung der Sächsischen Landesbibliothek (ging aus der Kurfürstlichen Bibliothek hervor) mit der Universitätsbibliothek der Technischen Universität (begann 1828 als Bibliothek der Königlich-Sächsischen Bildungsanstalt) zur Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB, eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands), 2002: Einzug der SLUB in den größten Bibliotheks-Neubau Deutschlands
Bildende Kunst (Malerei, Bildhauerei, Kunstgewerbe)
- ab 1505: Wirken des berühmten Malers der Reformationszeit Lucas Cranach d. Ä. als Hofmaler in Wittenberg (damals Hauptstadt des ernestinischen Teils von Sachsen)
- um 1560: Einrichtung der Dresdner Kunst- und Naturalienkammer auf Weisung von Kurfürst August von Sachsen (reg. 1553-1586; nicht mit August dem Starken verwechseln!) als Kunst- und Kuriositätensammlung zunächst in fünf Zimmern des Dresdner Residenzschlosses über den kurfürstlichen Wohnräumen, war der Grundstock für die späteren weltberühmten Dresdner Kunstsammlungen, 1587: eine erste Inventarliste der Kunstkammer verzeichnet etwa 100.000 Raritäten aus Sachsen, Deutschland, Europa und fernen Ländern (darunter Mineralien, Gemälde, Kleinplastiken, Werkzeuge und feinmechanische Instrumente)
- 1575: Berufung des bedeutenden italienischen Bildhauers und Architekten Giovanni Maria Nosseni an den sächsischen Hof (hatte großen Anteil am Aufbau der damaligen prächtigen Renaissance-Stadt Dresden)
- 1694-1763 (Augusteische Zeit, Regierungszeit von Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen - August dem Starken - und dessen Sohn Kurfürst Friedrich August II.): Aufbau von Kunstsammlungen von europäischem Rang aus Beständen der Kurfürstlichen Kunstkammer, durch Ankäufe und durch Beauftragung sächsischer Manufakturen, 1722: Aufbau einer Gemäldesammlung auf Weisung Augusts des Starken aus Beständen der Kunstkammer sowie durch Ankauf und durch Zusammenfassen von Gemälden aus mehreren sächsischen Schlössern, starke Erweiterung der Gemäldegalerie in der Regierungszeit von Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen durch umfangreiche Ankäufe, ab 1746: Einrichtung der Gemäldegalerie im Stallgebäude (dem späteren Johanneum), gehört seitdem zu den bedeutendsten Gemäldesammlungen Europas, fast alle großen Alten Meister der Malerei sind vertreten, Glanzstück: Raffaels "Sixtinische Madonna" (kam 1754 nach Dresden)
- ab 1698: Wirken von Goldschmied Johann Melchior Dinglinger als Hofjuwelier in Dresden (schuf einige der kostbarsten Kunstwerke des Grünen Gewölbes), 1731-1775: Wirken des berühmten Dekorgestalters Johann Joachim Kändler in der Königlichen Porzellan-Manufaktur Meißen, ab 1748: Wirken des bedeutenden venezianischen Vedutenmalers Bernardo Bellotto (Canaletto, 1721-1780) als Hofmaler in Dresden (schuf großartige Stadtansichten von Dresden und Pirna in detailgenauer Darstellung, diese gelten als ein Höhepunkt der europäischen Vedutenmalerei)
- 1765: Herausgabe des europaweit beachteten ersten gedruckten Katalogs der Dresdner Gemäldegalerie, die Galerie war frei zugänglich für das Dresdner Bürgertum und Besucher der Stadt, förderte die Liebe zur Kunst und bildete den künstlerischen Geschmack, zog viele Künstler nach Dresden, Beginn der Sammlung zeitgenössischer Kunst des 18. Jahrhunderts auf Anregung von Francesco Graf Algarotti (Kunstberater und Bildaufkäufer des sächsischen Hofes)
- 1764: Gründung der Königlich-Sächsischen Akademie der Bildenden Künste (Kunstakademie) auf Anregung von Christian Ludwig von Hagedorn (die Kunstakademie ging aus der seit 1680 in loser Form bestehenden Dresdner Zeichenschule / Malerakademie hervor), entwickelte sich schnell zum Zentrum des Dresdner Kunstlebens, zu den ersten Lehrern gehörten die Maler Anton Graff (ab 1766 Dresdner Hofmaler) und Adrian Zingg, 1768-1814: Graf Camillo Marcolini als Direktor der Kunstakademie, der Meißner Porzellanmanufaktur und der Königlichen Sammlungen
- 1801: Wechsel des natur-religiösen Malers Philipp Otto Runge von der Kopenhagener an die Dresdner Kunstakademie, entwickelte sich unter dem Einfluss von Ludwig Tieck und anderen Dresdner Romantikern zu einem bedeutenden Maler der Romantik, 1798-1840: Wirken des berühmten Malers der Romantik Caspar David Friedrich in Dresden
- 1829: Umzug der Sammlungen des Königlich-Sächsischen Altertumsvereins in das Palais im Großen Garten
- ab 1832: Professur des Bildhauers Ernst Rietschel an der Kunstakademie (begründete gemeinsam mit Ernst Hähnel die Dresdner Bildhauerschule), 1836-1877: Professur des Malers der deutschen Spätromantik Adrian Ludwig Richter an der Kunstakademie (ab 1828 Leiter der Zeichenschule der Königlichen Porzellan-Manufaktur Meißen)
- 1872-1876: Wilhelm Walther schuf das großartige Wandgemälde "Fürstenzug" (Ahnengalerie des Hauses Wettin) am Langen Gang des Dresdner Stallhofes (Sgrafitto-Wandbild 1907 durch eine Reproduktion auf Fliesen aus Meissener Porzellan ersetzt, 1978/79 restauriert)
- 1894: Einzug der Dresdner Kunstakademie in den repräsentativen Neubau an der Brühlschen Terrasse, Leiter der Kunstakademie waren ab 1895 der impressionistische Maler Gotthardt Kuehl und ab 1915 der bedeutende Impressionist Robert Sterl, 1897: Internationale Kunstausstellung in Dresden (Beginn der Tradition der Dresdner Kunstausstellungen)
- um 1900: Beginn eines regen Kulturlebens in Dresden mit einem ausgeprägten künstlerischen Reformbestreben (z. B. große Kunstgewerbeausstellung, erster deutscher Kongress für Denkmalpflege, Herausgabe der Zeitschrift "Kunstwart", Gründung des Dürerbundes)
- 1905: Gründung der weltberühmten expressionistischen Künstlergemeinschaft "Die Brücke" durch junge Künstler in der Dresdner Friedrichstadt (Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmitt-Rottluff, Emil Nolde, Erich Heckel, Fritz Bleyl, später auch Max Pechstein)
- 1918 (Ende der sächsischen Monarchie): Umwandlung der "Königlichen Sammlung für Kunst und Wissenschaft" in die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, 1922: Veranstaltung der II. Dresdner Kunst- und Antiquitäten-Auktion, auch Kunstwerke aus wettinischem Privateigentum versteigert, 1924: Gesetz über die Abfindung der Wettiner (Teile der Kunstsammlungen gingen in wettinischen Privatbesitz über)
- 1919: Gründung der Dresdner Gruppe der Neuen Sezession durch die Maler Otto Dix (ab 1926 als Kunstprofessor in Dresden tätig) und Conrad Felixmüller, Dresden war neben München ein Zentrum der Kunst der Neuen Sachlichkeit, hier wirkten z. B. Hans Grundig, Otto Griebel und Wilhelm Lachnit
- 1930: Eröffnung des neuen Grassi-Museums in Leipzig, 1931: Abspaltung der Galerie Neue Meister von der Dresdner Gemäldegalerie (diese besteht seitdem als Gemäldegalerie Alte Meister fort)
- 1933 (Machtübernahme der Nationalsozialisten): Entlassung namhafter Künstler und Gelehrter aus politischen oder rassischen Gründen (z. B. des Leipziger Gewandhauskapellmeisters Bruno Walter, des Leiters der Dresdner Staatskapelle Fritz Busch, des Operndirektors Gustav Brecher, des Philosophen Hans Driesch, des Malers Otto Dix und des Schriftstellers Victor Klemperer), Aussonderung vieler Werke aus den Dresdner Kunstsammlungen im Rahmen der Aktion "Entartete Kunst", Arbeits- und Ausstellungsverbot für zahlreiche Künstler wie z. B. solche der Neuen Sachlichkeit und des Expressionismus, 1933: Eröffnung der Ausstellung "Spiegelbild des Verfalls in der Kunst" im Dresdner Rathaus
- Februar 1945: Verlust nahezu aller Räumlichkeiten der Staatlichen Kunstsammlungen, der Dresdner Bibliotheken und vieler anderer Kultureinrichtungen in der Dresdner Innenstadt sowie auch von Teilen der Kunstbestände durch die englisch-amerikanischen Bombenangriffe
- 1946: Abtransport vieler Kunstschätze als "Beutekunst" in die Sowjetunion, Wiederherstellung der Kunstakademie an der Brühlschen Terrasse, Wiederaufnahme regelmäßiger Kunstausstellungen und Sonderausstellungen im Albertinum, 1956 (750-Jahr-Feier Dresdens): Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister in der wiederhergestellten Sempergalerie mit den bis dahin von der Sowjetunion zurückgegebenen Bildern, bis 1958: Rückkehr der meisten Kunstschätze aus der Sowjetunion, 1959: Eröffnung der ersten Ausstellung des "Grünen Gewölbes" im wiederhergestellten Albertinum
- seit 1990: umfassende Sanierung der sächsischen Museen und Kunsteinrichtungen, 1999: Einigung zwischen dem Haus Wettin und dem Freistaat Sachsen über die Rückgabe von Kulturgütern (die Wettiner erhielten etwa 6.000 Kunstgegenstände zurück), 2000: Baubeginn für das Museum der Bildenden Künste in Leipzig (erster Museumsneubau der neuen Bundesländer nach der deutschen Wiedervereinigung)
Theater & Literatur
- Ende des 16. Jahrhunderts: Gastspiel englischer Komödianten am Sächsischen Hof auf Empfehlung des Kurfürsten von Brandenburg (machten unter anderem Stücke von Shakespeare in Sachsen bekannt)
- 1669: Gründung einer der ersten Schauspielergruppen Deutschlands in Sachsen durch Johann Veltheim, 1685-1691: Wirken der "berühmten Bande des Magisters Velten" am sächsischen Hof (durch ein kurfürstliches Dekret am Hof verpflichtet, führte unter anderem ins Deutsche übersetzte Stücke von Moliére und Corneille auf)
- 1725: Tätigkeit des Gelehrten und Schriftstellers Johann Christoph Gottsched als Privatdozent an der Universität Leipzig, ab 1734 als Literaturprofessor
- 1737: Reform der deutschen Theaterkunst (nach dem Vorbild des französischen Schauspiels) durch die damals beste deutsche Theatergruppe Haak-Hoffmannsche-Polnisch-Sächsische-Komödiengesellschaft mit der talentierten Schauspielerin Friederike Caroline Neuber ("Neuberin"), im höfischen Dresden (das die italienische Oper und pompöse Festaufführungen liebte) erhielt Caroline Neuber wenig Beachtung und keinen Zugang zum Hoftheater (starb 1760 verarmt in Dresden-Laubegast)
- 1729-1734: Christian Fürchtegott Gellert und 1741-1746: Gotthold Ephraim Lessing als Schüler der fürstlichen Landesschule ("Fürstenschule") Meißen, Gellert ging dann als Theologiestudent an die Leipziger Universität (Professur ab 1751), 1765-1768: Studienzeit des "Dichterfürsten" Johann Wolfgang von Goethe in Leipzig
- 1766: Bau des Leipziger Theaters, entwickelte sich zu einer bedeutenden Pflegestätte des Schauspiels
- 1813: der Schriftsteller der Romantik E.T.A. Hoffmann (damals Kapellmeister der Secondaschen Wandertruppe) erlebte die Kapitulation Dresdens und das Ende der Napoleonischen Kriege in Sachsen (schilderte in seinen Briefen und Tagebüchern das Elend jener Zeit), Aufschwung des sächsischen Theaterschaffens unter dem russischen Gouverneur Repnin-Wolkonski (residierte nach der Niederlage Napoleons und des mit diesem verbündeten Königreiches Sachsen in Dresden), Umwandlung des Hoftheaters in ein Staatstheater, nun wurden z. B. Stücke von Goethe, Schiller, Lessing, Grillparzer, Kleist und Calderón aufgeführt, 1815: Rückgängigmachen der Fortschritte im Theaterschaffen durch den aus Berlin zurückkehrenden König
- 1814: Wirken des Philosophen Arthur Schopenhauer in Dresden, schrieb hier 1814-1818 sein Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung" (eines der bedeutendsten philosophischen Werke des 19. Jahrhunderts)
www.schopenhauer-dresden.de - 1819-1841: der bedeutende Dichter der Romantik Ludwig Tieck bestimmte das Dresdner literarische Leben (ab 1824 Dramaturg in Dresden, ging 1842 aus Enttäuschung über die konservativen Dresdner Verhältnissen nach Berlin)
- 1830/31: bürgerliche Reformen in Sachsen, Abschwächung der Zensur des künstlerischen Schaffens (vorrübergehend moderatere Zensur als in Preußen oder Österreich)
- 1842: Gründung des "Leipziger Schriftsteller-Vereins" (förderte sächsische Künstler mit Unterstützungsfonds)
- ab 1844: Wirken der Schauspieler Eduard und Emil Devrient in Dresden (letzterer war auch ein berühmter Sänger)
- um 1870: Aufenthalt der Schriftsteller Henrik Ibsen, Iwan Turgenjew und Fedor Dostojewski in Dresden
- 1878: Eröffnung des nach Plänen Gottfried Sempers errichteten neuen Königlichen Hoftheaters (des zweiten Hoftheaters, heute Semperoper genannt; das ebenfalls von Semper gebaute erste Hoftheater war 1869 abgebrannt)
- 1888: Fertigstellung des Albert-Theaters am Albertplatz in der Dresdner Neustadt (es fiel den Bombenangriffen im Februar 1945 zum Opfer) als neue Spielstätte des Hoftheaters (nun getrennt von der Königlichen Oper)
- 1902: Gründung des Zirkus Sarrasani (seinerzeit das größte Zirkusunternehmen der Welt) in Dresden
- bis 1912: Entstehung der berühmten Romane des Reise- und Abenteuerschriftstellers Karl May in Radebeul bei Dresden, 1927: Eröffnung des bedeutenden völkerkundlichen Indianermuseums auf Karl Mays Radebeuler Wohngrundstück
- 1913: Eröffnung der Sächsischen Landesbühne in Dresden und der neuen Leipziger Volksbühne
- 1918 (Ende der Monarchie): Umwandlung des Hoftheaters in das Sächsische Landestheater (später Staatstheater), die anfänglich gespielten sozialkritischen Stücke wurden von dem sehr konservativen Dresdner Millieu bald in das Experimentiertheater Aktuelle Bühne verwiesen
- 1945: schnelles Wiederanlaufen des Dresdner Theaterbetriebes nach dem Zweiten Weltkrieg - jedoch nur behelfsmäßig in der ehemaligen Tonhalle an der Glacisstraße in der Neustadt (alle Theatersäle der Dresdner Innenstadt waren bei den Bombenangriffen zerstört worden), die Tonhalle fungierte nun als das "Kleine Haus" der Staatstheater
- 1948: Umzug des Staatstheaters und der Staatskapelle in das wiederhergestellte Schauspielhaus am Dresdner Postplatz, teilten sich in diese Spielstätte bis zur Fertigstellung der wiederaufgebauten Semperoper im Jahr 1985, 1995: umfassende Restaurierung des Schauspielhauses
Musik & Künstlerischer Tanz
- 1548: Unterzeichnung der Cantorei Ordnung genannten Geburtsurkunde der "Dresdner Musikalischen Kapelle", d. h. der Sächsischen Hofkapelle (heute Sächsische Staatskapelle), durch Kurfürst Moritz von Sachsen (reg. 1547-1553), aus der Dresdner Musikalischen Kapelle gingen später auch die Dresdner Kapellknaben hervor, erster Hofkapellmeister war der Torgauer Kantor und "Sengermeister" Johann Walter (spätere Kapellmeister kamen auch aus Italien, den Niederlanden und Frankreich), die Hofkapelle spielte in der Kirche, an der kurfürstlichen Tafel und bei Festlichkeiten und Umzügen, der Praeceptor sorgte für den musikalischen Nachwuchs
- 1617-1672: Wirken von Heinrich Schütz als Hofkapellmeister in Dresden (komponierte um 1627 die erste deutsche Oper "Daphne", führte die Hofkapelle während des Dreißigjährigen Krieges mit großem persönlichen Einsatz)
- 1694-1763 (Augusteische Zeit: Regierungszeit von Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen - August dem Starken - und Kurfürst Friedrich August II.): Vorherrschen der italienischen Oper im Musikgeschehen, 1719: Eröffnung von Pöppelmanns Opernhaus (beim Maiaufstand 1849 zerstört), hohe musikalische Qualität der Hofkapelle unter Hofkapellmeister Antonio Lotti, viele der Musiker galten als Virtuosen auf ihrem Instrument, 1731-1763: Wirken von Johann Adolph Hasse als Hofkapellmeister und seiner Gattin Faustina Bordoni als berühmte Opernsängerin in Dresden, überaus spektakuläre Aufführungen der italienischen Oper (bis zu 400 Mitwirkende und 100 Pferde vor prächtigen Kulissen mit echten Wasserfällen)
- 1723: Johann Sebastian Bach zum Thomaskantor in Leipzig berufen, war ab 1736 Compositeur bey der Königl. Hof Capelle, spielte gelegentlich auch die Silbermann-Orgeln in der Dresdner Frauenkirche und der Sophienkirche
- 1756-1763 (Siebenjähriger Krieg): Niedergang des Kulturschaffens, die ehemalige Vorrangstellung Kursachsens in der deutschen Kunst blieb für lange Zeit nur noch in der Musik erhalten, um 1815: Ende der etwa 250-jährigen Tradition der italienischen Oper im Dresdner Musikleben
- ab 1781: Gewandhauskonzerte im neu erbauten Leipziger Gewandhaus unter der Leitung von Adam Hiller
- 1807: Gründung der Singakademie durch den Dresdner Hoforganisten Anton Dreyssig
- 1817-1826: Wirken von Carl Maria von Weber als Hofkapellmeister und Musikdirektor in Dresden, komponierte hier die Opern "Freischütz", "Euryanthe" und "Oberon"
- 1835: Felix Mendelssohn Bartholdy zum Direktor des Leipziger Gewandhausorchesters berufen, gründete 1843 in Leipzig das erste deutsche Konservatorium, in Leipzig wirkten zu jener Zeit auch Albert Lortzing, Robert Schumann und Clara Schumann
- 1843: Richard Wagner (Kindheit in Dresden, Schüler der Kreuzschule) zum Hofkapellmeister am Königlich-Sächsischen Hoftheater berufen, musste wegen seiner Teilnahme am Dresdner Maiaufstand 1849 aus Sachsen fliehen
- 1844-1850: Wirken des Komponisten Robert Schumann in Dresden (leitete die Liedertafel, gründete 1847 den Verein für Chorgesang)
- 1854: Gründung des Dresdner Tonkünstlervereins, 1865: Veranstaltung des I. Deutschen Sängerbundfestes in Dresden mit 20.000 Teilnehmern
- 1870: Gründung der Dresdner Philharmonie im neuen Konzertsaal des Dresdner Gewerbevereins an der Ostra-Allee, zunächst Gewerbehausorchester genannt (lässt sich über das Stadtmusikkorp, die Stadtkapelle und die Ratsmusiker bis auf die Stadtpfeifer und Turmbläser von 1420 zurückführen)
stadtpfeifer.webs.com - Ein Dresdner Ensemble für Renaissancemusik auf historischen Instrumenten, zugleich die "älteste Band Dresdens" (gegründet 1420). Außerdem: Die Geschichte der städtischen Musik in Dresden - ab 1885: philharmonische Konzerte des Gewerbehausorchesters unter der Leitung von Jean Louis Nicodé (Gäste am Dirigentenpult waren u. a. Richard Strauss, Antonin Dvorák und Peter Tschaikowski)
- 1872-1914: Wirken von Ernst Edler von Schuch als Hofkapellmeister und zuletzt auch als Generalmusikdirektor in Dresden, dirigierte ab 1901 legendäre Uraufführungen der Werke von Richard Strauss (dieser pflegte bis zu seinem Lebensende einen innigen Kontakt zur Dresdner Hofkapelle)
- um 1900: Gründung der Dalcroze-Schule für künstlerischen Tanz durch den Schweizer Tanzpädagogen Emile Jaques-Dalcroze in Dresden-Hellerau, brachte die Kunst des rhythmischen Tanzes nach Dresden, 1920: Gründung einer Schule für künstlerischen Tanz (modernen Ausdruckstanz) in Dresden durch die berühmte Tänzerin und Choreographin Mary Wigman, die Schule erlangte nicht zuletzt durch die Tänzerin Gret Palucca Weltruhm, 1925: Gründung der Tanzschule von Gret Palucca, setzte in der Zeit der DDR die große Dresdner Tradition des künstlerischen Tanzes fort
- 1918 (Ende der Monarchie): Umwandlung der Hofkapelle in die Sächsische Staatskapelle, ab 1922: Leitung durch Generalmusikdirektor Fritz Busch (1933 von den Nationalsozialisten aus dem Amt vertrieben), unter ihm und Nachfolger Karl Böhm galt die Sächsische Staatskapelle als eines der besten Orchester der Welt
- seit 1920: Veranstaltung des Deutschen Bachfestes in Leipzig
- 1934-1942: Paul van Kempen als Leiter der Dresdner Philharmonie, begründete die Dresdner Musiktage und den Dresdner Musiksommer mit den Zwingerserenaden
- 1945: Zerstörung der Spielstätten der Staatskapelle (Semperoper) und der Dresdner Philharmonie durch die englisch-amerikanischen Bombenangriffe, nach Kriegsende erste Konzerte der Staatskapelle und der Philharmonie im Kurhaus Dresden-Bühlau, ergreifende Konzerte des Kreuzchores und der Dresdner Philharmonie inmitten der Trümmer der Innenstadt, 1948: Einzug der Staatskapelle gemeinsam mit dem Staatstheater in das wiederhergestellte Schauspielhaus, 1954: Einzug der Staatlichen Operette in das Apollotheater (ehem. Feenpalast) in Dresden-Leuben, 1969: Fertigstellung des Kulturpalastes an der Nordseite des Altmarktes als neue Spielstätte der Dresdner Philharmonie, seit 1970: alljährliches Dresdner Dixieland-Festival (größtes Dixieland-Event Europas) mit Musikliebhabern aus aller Welt, seit 1978: alljährliche Dresdner Musikfestspiele, 1985 (zum 40. Jahrestag der Zerstörung Dresdens): Einweihung der wiederaufgebauten Semperoper (Spielstätte der Staatskapelle)
- 1960: Eröffnung des Leipziger Opernhauses, 1981: Einweihung des Leipziger Neuen Gewandhauses (das Leipziger Gewandhausorchester erlangte unter seinem Chefdirigenten Kurt Masur weltweite Berühmtheit, dieser trug in der Zeit der politischen Wende 1989/90 wesentlich zum friedlichen Verlauf dieser politischen Ereignisse bei)
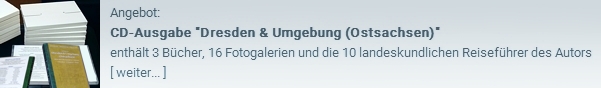
nach oben
